... / INFOTHEK / STILKUNDE
STILKUNDE
Kunstgeschichtliche Übersicht
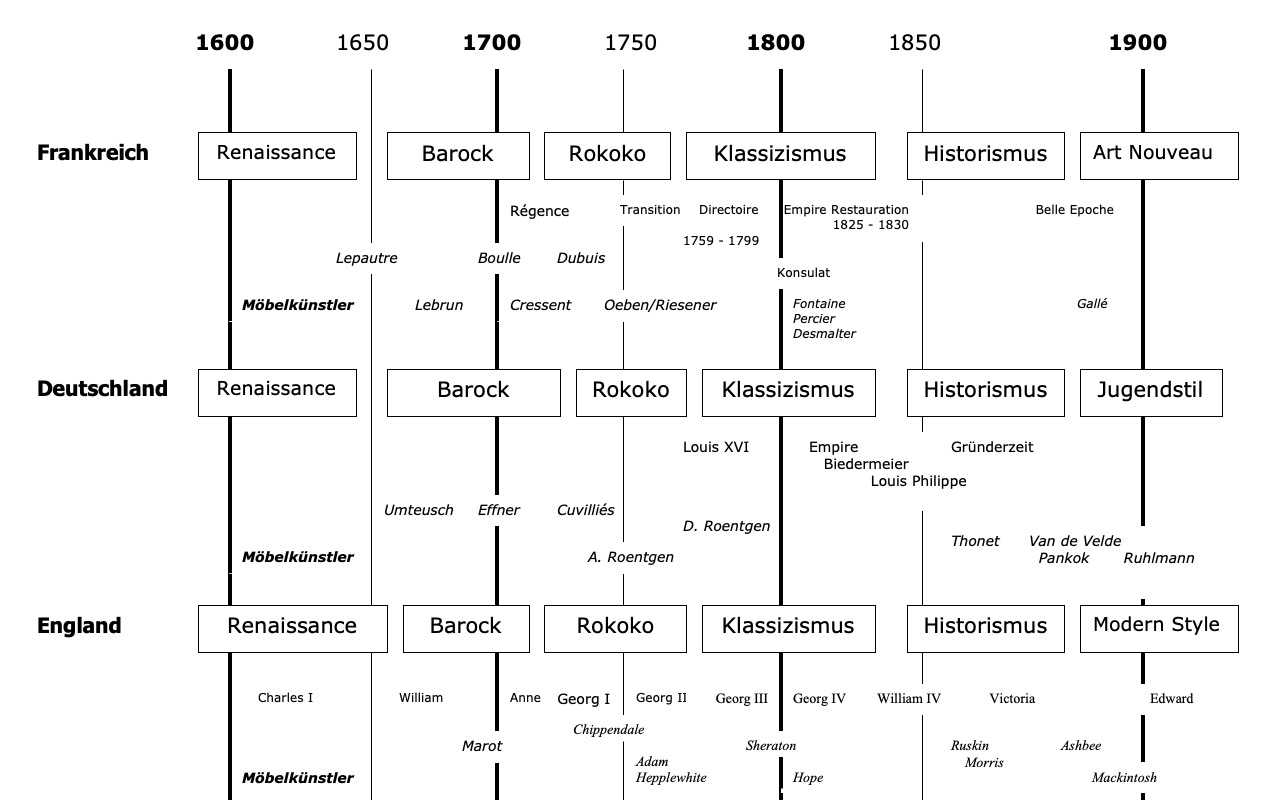
Sie lieben Antiquitäten?
Gehen wir davon aus. Warum? Hier beginnt das Geheimnisvolle, das Persönliche. Ist es die Freude, über Dinge zu verfügen, die ein Mehrfaches der eigenen Lebenszeit gesehen haben? Ist es der heimliche Wunsch nach Dauerhaftigkeit und Kontinuität? Ist es der Kitzel, ein “königliches“ Stück sein eigen zu nennen, die Macht der Vergangenheit greifbar zu haben?
Oder träumen Sie sich gerne in die Vergangenheit und lassen sich von alten Stücken dazu verführen? Oder ist es – und das wohl meistens – die Freude an Geschmackvollem, Gekonntem, Vollbrachten? Schlechtes überdauert selten.
Die Zeit liest aus. So kommt es, dass Erlesenes aus längst vergangenen Epochen zu uns spricht, unsere Phantasie anregt, uns zeitlose Schönheit verheißt über allen modischen Wechsel hinweg. Reizt nicht die Frage, welche “Mode“, welche Menschen, welche Vorstellungen und Notwendigkeiten solche Stücke geschaffen haben ?
Im Einführungsteil – Stilmerkmale – werden Ihnen die typischen Formen, Materialien und Techniken der einzelnen Stilepochen kurz und anschaulich vorgestellt. Auch dem “Einsteiger“ wird es ermöglicht, die wesentlichen, prägenden Stilmerkmale zu erkennen.
Die Stilgeschichte will Ihnen wie in einem Kaleidoskop farbige Splitter der Zeit zeigen, in der Ihre Schätze entstanden. Wie die Menschen lebten, wonach sie strebten, wie sie ihr Gefühl für Schönes und Zweckmäßiges zum Ausdruck brachten. Aber auch welche Nöte, Wirren und Anfechtungen sie zu durchleben hatten.
Ein Kaleidoskop möchte sie sein, diese Stilkunde. Mehr nicht. Lassen Sie sich führen zu den Werkstätten vergangener Moden. Zeigt uns ihre Vielfalt doch, wie viel dem Menschen möglich. Und als Möglichkeit ist all das in uns, den Heutigen, aufgehoben. So entdecken wir im Reichtum der Vergangenheit den Reichtum unserer eigenen Möglichkeiten. Ist das nicht verführerisch genug?
RENAISSANCE
BAROCK
ROKOKO
LOUIS SEIZE
KLASSIZISMUS
◌ KLASSIZISMUS EMPIRE
◌ KLASSIZISMUS BIEDERMEIER
◌ KLASSIZISMUS REGENCY
HISTORISMUS
JUGENDSTIL
ART DECO
50er Jahre
RENAISSANCE
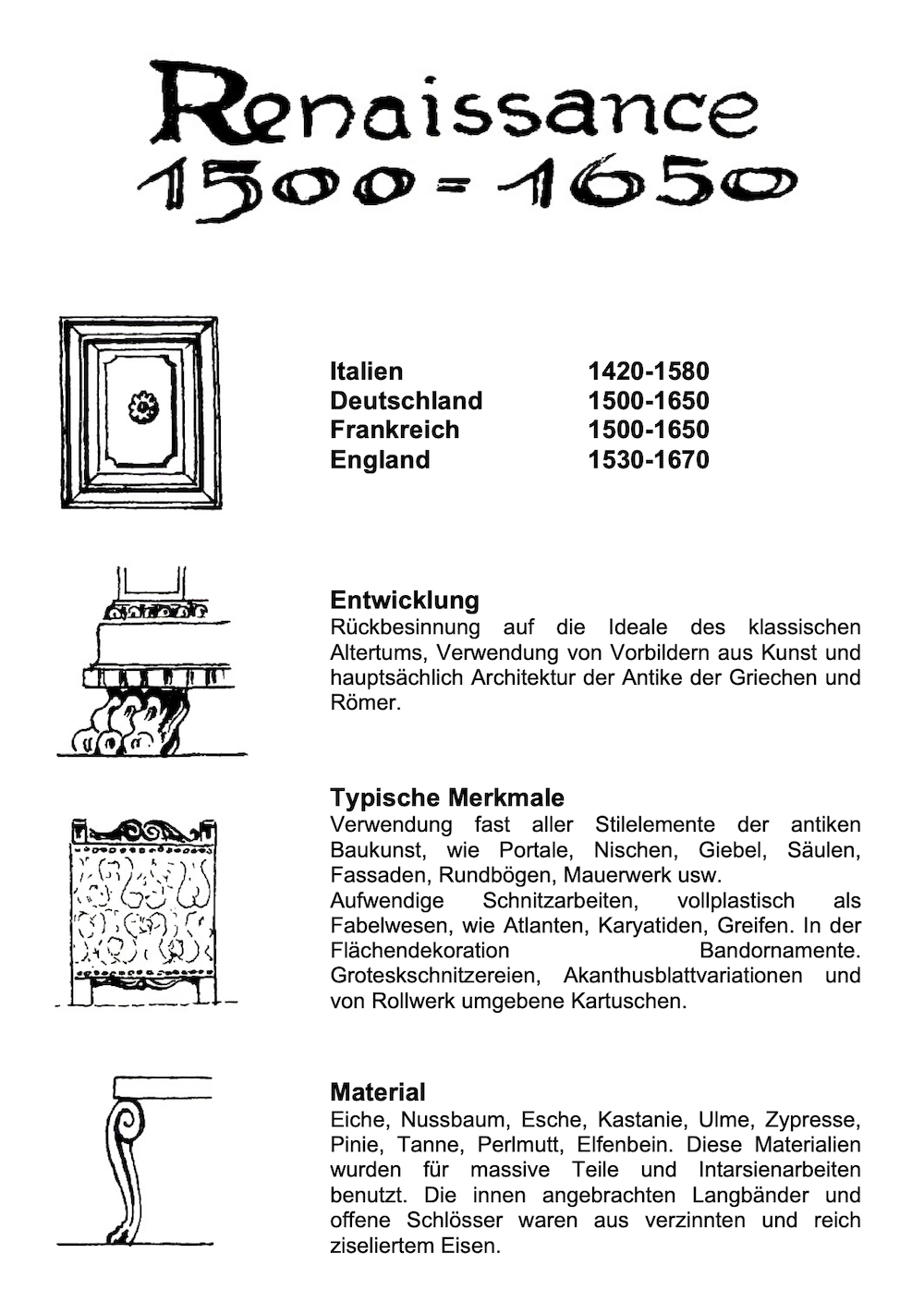
Das Wort Renaissance stammt aus dem Französischen und bedeutet Wiedergeburt. Erstmals wird es 1855 von dem Franzosen Michelet benutzt; der deutsche Kunsthistoriker Jakob Burckhardt verwendet den Begriff Renaissance 1860 als Stilbezeichnung. Tatsächlich leitet sich Renaissance von dem italienischen Wort “rinascità“ ab, das der Maler und Kunsttheoretiker Giorgio Vasari im Jahre 1550 in seinen Veröffentlichungen einsetzt, um die Wiedergeburt der Kunst im Italien des Quattrocento und Cinquecento zu beschreiben. Im Gegensatz zu Vasari versteht Burckhardt unter dem Begriff Renaissance die Wiedergeburt des Geistes der Antike. Die Epoche der Renaissance überregional festzulegen, tritt auf Hindernisse. In Italien erlebt sie ihre Blüte von 1420-1530, in Deutschland erst von 1495-1600.
Renaissance bedeutet in erster Linie eine Geisteshaltung, die alle Lebensbereiche des Menschen durchdringt. Die Wiederentdeckung der Antike und ihres Kosmos kann durchaus verstanden werden als Reaktion. Der Forschergeist des Menschen rennt immer stärker gegen die Grenzen des mittelalterlichen Weltbildes. Die Welt wird entdeckt, im Großen wie im Kleinen. Naturwissenschaftler, Künstler und Abenteurer reißen die Mauern nieder, die die Menschen bis dahin umgeben und erweitern ihren Horizont in unvorstellbarem Maße. Die bekanntesten Vertreter dieser Entwicklung sind Columbus, Leonardo da Vinci. Gleichzeitig wollen Luther, Calvin und Ignatius von Loyola, voller Inbrunst, noch einmal den Gedanken des Gottesstaates verwirklichen.
Vergeblich – der Abbau der Religion und der Vormachtstellung der Kirche und ihrer Ideale sind unaufhaltsam. Eine lange Reihe von Zweiflern und Fragern bricht aus der blinden Geborgenheit der mittelalterlichen Glaubensvorstellungen aus. Immer lauter ertönen die Stimmen von Sittenrichtern, die das “Lotterleben“ hinter Klostermauern und des Vatikan anprangern. Der prominenteste Vertreter dieses degenerierten Lebensstils ist Papst Alexander VI. aus dem Hause Borgia. Durch die intensive Auseinandersetzung mit der Antike wird die Kunst säkularisiert. Da ihr der einende, religiöse Hintergrund der Antike fehlt, ist die Renaissance allgemein als profane Kunst zu werten. Gewiss gibt es religiös motivierte Kunstwerke, doch der Hauptantrieb ist Befreiung. Insofern kann man die Renaissance als die erste weltliche Kunstepoche bezeichnen. Neben der Antike schöpft der Künstler aus der Natur. Er verzichtet auf die Anlehnung an die kosmische Schöpfung, vielmehr sucht er Vollendung im irdischen Bereich. Wiederentdeckung der Antike, Wiederentdeckung der Natur – beide führen zum Menschen. Die Entwicklung führt vom Begreifen der Antike in der Frührenaissance bis zum Ersetzen der Natur durch geistige Ideale in der Spätrenaissance und dem Manierismus.
Kunst entsteht aus dem Intellekt, überkommene Traditionen werden überwunden, der Geist steht über dem Handwerk. Der Renaissance-Künstler schafft Meisterwerke in mehreren Techniken. Das bekannteste Beispiel dafür ist das Universalgenie Leonardo da Vinci: Er ist Maler, Bildhauer, Architekt, Goldschmied, Forscher, Erfinder. Auch Raffael und Michelangelo sind vielseitig begabt und tätig. Die Formensprache der Renaissance ist vielfältig und natürlich. Die gotische, alles beherrschende Vertikaltendenz ist abgelöst von der Harmonie zwischen horizontalen und vertikalen Elementen. Die Frührenaissance zeigt Feinheit, Leichtigkeit und scharfe Prägnanz, in der Hochrenaissance gelten eher eine weichere Auffassung und eine Neigung zur Vereinfachung. Inspiriert von der römischen Kaiserzeit konzentrieren sich die Kräfte jetzt eher auf das Großartige, Schwere, man will der Kunst der antike Ebenbürtiges schaffen. Die Entwicklung geht von bewusster Knappheit hin zur Aufnahme immer mehr menschlicher Ausdrucksmöglichkeiten. Angestrebt ist die Sichtbarmachung menschlicher Gefühle und die Umsetzung der Formen aus der Natur in die Sprache der Kunst.
Nach Michelangelo ist der Mensch in seiner Nacktheit der Mittelpunkt des Universums. Der Mensch bewegt sich natürlich in dem ihn umgebenden Raum, alles soll Harmonie ausstrahlen. Der Mystizismus verschwindet nicht, sondern drückt sich anders aus: in der Regelmäßigkeit des Quadrats, Rechteckes, Würfels, Dreiecks und Kreises. Diese einfachen geometrischen Grundformen setzen den Menschen in eine logische Beziehung zu seiner Umwelt. Der Kreis als Symbol der Vollkommenheit Gottes ist gleichzeitig eine natürliche Form. Daher ist er in der Renaissance der ideale Grundriss für ein Gotteshaus.
Nach der naturgetreuen Darstellung der Menschen und der Beobachtung der Natur entwickelt sich die Gabe des Künstlers, sich vorzustellen, was es noch nicht gibt. Damit ist dem zweiten Zweig der Renaissance-Kunst “die Tür geöffnet“: die phantastische Kunst, die uns nur im Geist und in der Seele des Künstlers existierende Dinge darstellt. Haben auch Sie den Roman “Der Name der Rose“ gelesen, Vorahnung des Kommenden? Humanistisches Lebensgefühl führt zur Entdeckung des Individuum. Die Wiederentdeckung des selbstbewussten Menschen aus der Antike hat zur Folge die rationale Durchdringung der Welt als geordnetes Gefüge von Mensch, Natur und Gottheit (Kosmos). Das öffnet den Blick für neue Räume und Ordnungen. Das alte, auf Glauben beruhende, dämonisierte Weltbild des Mittelalters zerbricht.
Neues Bewusstsein für das eigene Erleben und das eigene Nachforschen, die eigene Persönlichkeit und Mode. So bekommt das forschende Einzelwesen Gültigkeit, solange es den Gesetzen des Kosmos nicht widerspricht. Selbstverständlich kennt diese Suche auch Übertreibungen. Die neue Vernunft sucht spekulierend – Kant wird manchen Gedankengang dieser Zeit in seiner “Kritik der reinen Vernunft“ (1781) in Schranken weisen – Wege ins Unendliche, in die Welt der Astrologie, der Magie. Sie ist auf der Suche nach Wahrheit im Reich des Dämonischen, der Hieroglyphen und Symbole (Faustisches Streben!). Ob Scharlatan, ob Begründer der modernen Naturwissenschaften, das Suchen allein bestimmt ihren Wert.
Vernunft als “Schau des Wahren“ und christlicher Glaube treten gleichberechtigt nebeneinander, philosophischer Neu-Platonismus (Cosimo di Medici) setzt Gott und Wahrheit gleich. Somit kann der wahrheitssuchende Mensch an Gott nicht fehlgehen und leitet damit seine Berechtigung zum Widerstand gegen die Kirche ab.
So streben Fürsten, Gelehrte und andere nach dem Ideal des “huomo universale“, des allseitig schönen, wahren und gebildeten Menschen. Nun wird verständlich, weshalb der künstlerische Ausdruck des Renaissance-Menschen untrennbar als Wahrheitssuche verstanden werden muß. Den Lehren der Kirche aus eigenem Wissen und ästhetischem Empfinden zu widersprechen ist nicht mehr gottesleugnerisch. Solches Denken, solches Lebensgefühl führt zu großen Taten: Giordano Bruno und Galileo Galilei bezahlen für ihr aufrührerisches Denken und Forschen: Bruno mit dem Leben, Galilei mit lebenslangem Berufsverbot.
Vor dem Hintergrund der römischen und griechischen Antike treibt Europa in neuem religiösen, poetischen und sozialen Geist zu einer alles verändernden Kulturblüte.
Geschichte
Geschichtlich und politisch ist die Renaissance die Zeit der Unruhigen und Schwarmgeister – seit über 100 Jahren gärt und rumort es in Europa an allen Ecken und Enden, der Durchbruch zur Neuzeit steht unmittelbar bevor. Der Vatikan hat durch sein Exil in Avignon an Macht verloren, das verhilft den norditalienischen Städten zu Autonomie und wirtschaftlicher Größe. Die großen Patrizierfamilien, vornehmlich in Florenz, zeichnen sich durch hohen Realitätssinn aus und präsentieren dem Papst eine gefestigte Industrie, Hochfinanz, intellektuellen Ernst und moralische Disziplin. Dies lässt den Oberchristen nicht ruhen. Schließlich gelingt es dem Vatikan, getragen von der Sehnsucht nach einem Römischen Reich, in der Hochrenaissance zum bedeutendsten Mäzen aufzusteigen; die Päpste und ihre unvorstellbare Prunksucht prägen das Kunsthandwerk.
1453 erobern die Türken Konstantinopel, das oströmische Reich geht unter. Während die norddeutsche Hanse an Bedeutung verliert, steigen in Süddeutschland die Kaufherrendynastien der Fugger und Welser zu den mächtigsten Geldmagnaten der Zeit auf. Sie sind ohne Zweifel das größte “Leihhaus“ der westlichen Hemisphäre. Fast jeder Fürst von Rang und Namen bis hinauf zum Kaiser und zum Papst ist Schuldner bei ihnen. Derweil sponsort Königin Isabella von Spanien, gegen den Willen ihres königlichen Gemahls, den unbekannten Genuesen Columbus. Diese Großzügigkeit führt 1492 zur ungeplanten Entdeckung Amerikas. 1491 werden – oh Ironie des Schicksals – Heinrich VIII. von England und Ignatius von Loyola geboren. Heinrich ist der englische König mit der unmäßigen, unorthodoxen Ehepolitik, die zum Ausbruch Englands aus der römisch-katholischen Kirche führt, während Ignatius als Gründer des Jesuitenordens eben dieser angeschlagenen Kirche wieder zu Ansehen verhilft.
Die Völker Europas bangen der Jahrhundertwende (1500) entgegen, an der nach allgemeinem Verständnis der Weltuntergang stattfinden soll. Aus Venedig zurückgekehrt, zeichnet Dürer unter dem Eindruck von Ketzerverbrennungen (Savonarola in Florenz) die Apokalypse. Aus solcher Weltuntergangsstimmung heraus lässt sich allein die Wirkung von Luthers (zunächst in Latein verfassten) 95 Thesen erklären, die in aller Unschuld als interne theologische Auseinandersetzung gedacht waren. Mit Hilfe des gut fünfzig Jahre früher erfundenen Buchdrucks gelingt eine unbeabsichtigte, ungeheuerliche Verbreitung von Luthers Sätzen in ganz Deutschland, ja, man kann sagen, in ganz Europa.
Dem Volk dringt Neues in alle Poren, es begehrt auf. Papst Leo X., ein Medici, kann dieses Treiben nicht dulden. Die Kirche in ihrem Hierarchischen Ordnungsglauben wehrt sich gegen die “Gleichmacherei“ der Protestanten. Während Martin Luther nur für und durch den Glauben lebt, ist Erasmus von Rotterdam die Verkörperung des vornehmen, weltlichen Bildungsmenschen der Renaissance, der Luther scharf kritisiert: “Wo das Luthertum herrscht, ist Untergang der schönen Wissenschaften“. Soweit die beiden bekanntesten und markantesten Antipoden im deutschsprachigen Raum. Ähnlich freundlich gehen Michelangelo und Leonardo da Vinci miteinander um.
1521 (Reichstag zu Worms) wird Ignatius von Loyola zum Gottesmann und indirekt zu Luthers Gegenspieler. Er unterbreitet Papst Paul III. ein Rettungsangebot für die katholische Kirche, das dieser 1540 begeistert aufnimmt. Mit einem eleganten Rückfall ins Mittelalter führt Rom 1541 die Inquisition wieder ein, die Epoche der Gegenreformation beginnt. Gleichzeitig wird Intoleranz zum wichtigsten, gemeinsamen Merkmal von Christen aller Richtungen. Ein Meer von Blut und Tränen überschwemmt Deutschland, die Bauernkriege brechen aus. “Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann“. Dies Wort stammt aus der Zeit. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa erheben sich immer wieder Teile de Bevölkerung gegen ihre Obrigkeit. Einem Tilman Riemenschneider werden in der Haft die Hände gebrochen, weil er sich den Anordnungen der Oberen nicht beugen will. Die sporadischen Brände des 15.Jahrhunderts verdichten sich zu einer Art Kreuzzugsglauben gegen alles, was von oben kommt. Man brandschatzt, zerstört, tötet im Namen Gottes – nur ist es jetzt das gemeine Volk und nicht Kirche und Herrscher, die es ihm jahrhundertelang vorgemacht haben.
Der Bauernkrieg ist eine einzige soziale Tragödie. Der seit Menschengedenken gnadenlos geopferte Bauer und einfache Stadtmensch zieht mit seinesgleichen als Bruder – ohne militärische Führung und Erfahrung – gegen den kampferprobten Adel und die Kirche. Die Folgen sind katastrophal. Neben Trauer um Mensch und Besitz bleiben nur Enttäuschung und Resignation. Die Glaubenszugehörigkeit wird jetzt von den kleinen Landesfürsten verordnet.
Die religiöse Erneuerung in Europa entartet zu machtpolitischen Auseinandersetzungen. Die wohlgemeinten und von vielen geforderten Reformideen degenerieren rasch zum Alibi von allerlei Machthabern, ihre Ansprüche durchzusetzen. Luther hat vor dem Reichstag zu Worms sein Leben riskiert, 60 Jahre später sichert sich der französische König Heinrich IV. mit seiner Rückkehr zum Katholizismus Krone und Land, “Paris ist eine Messe wert“. Bezahlt wird die “Pariser Bluthochzeit“ mit dem Progrom gegen die Hugenotten (Bartholomäusnacht). Der strenggläubige, spanische König Philipp II. (nachzulesen in Schillers “Don Carlos“) verfolgt gnadenlos Macht- und Glaubensziele, und zwar in dieser Reihenfolge, mit jedem erdenklichen Mittel. Während er eifersüchtig über die Rechtgläubigkeit seiner Untertanen in Europa wacht, entwickelt sich England unter Königin Elizabeth I. vom unbedeutenden Inselstaat zur Weltmacht und wird neben den freien Niederlanden zum Mekka für Andersgläubige und Verfolgte. Doch die Revolution der Naturwissenschaften, die Eroberung des Kosmos und die religiöse und soziale Erneuerung lassen sich nicht mehr rückgängig machen.
Ausbreitung der Renaissance
Ausgehend von Italien fallen die Impulse der Renaissance in ganz Europa auf fruchtbaren Boden. Allerdings werden sie in den jeweiligen Ländern zu sehr unterschiedlichen Zeiten aufgenommen, je nach geographischer, politischer und kultureller Lage des betreffenden Landes. Wie schon erwähnt, ist Italien die Wiege der Renaissance. Dort ist durch das Vorhandensein antiker Vorbilder die Entwicklung fast übergangslos, zumal sie schon seit dem Ende des 14. Jahrhunderts ein lebhaftes Interesse am antiken Erbe zeigt, vor allen Dingen in den Geistes- und Naturwissenschaften. Nachdem die Vorherrschaft des französischen Geschmacks gebrochen ist, tritt eine Rückbesinnung auf eigene Traditionen ein. Diese Neigung kann man als Rückführung der eigenen urbanen Ursprünge auf das antike Rom bezeichnen. Nach der Schwächung des Kaisertums erstarken die Stadtstaaten wirtschaftlich und politisch, allen voran die toskanischen Städte Florenz, Pisa, Siena. Schließlich werden die Päpste zu den bedeutendsten Kunstförderern. Heerscharen von Künstlern pilgern nach Italien, wandernde Künstler werden von dort an europäische Fürstenhöfe gerufen. Klarheit, Maß und Großzügigkeit gehören zu Florenz, zu Rom gehört Großartigkeit. Die Wiederentdeckung der zehnbändigen Architekturtheorie Vitruvs (33 n. Chr.) im Kloster St. Gallen und ihr Abdruck 1486 in Rom bilden die Grundlage für die Blüte der Architektur in der italienischen Hochrenaissance. Trotz seiner benachbarten Lage reagiert Frankreich sehr zögerlich auf die neue Strömung und nimmt sie erst spät auf. Zunächst rezipieren die französischen Kunsthandwerker nur die dekorativen Details der italienischen Renaissance unter Auslassung der inneren Gesetzmäßigkeit oder konstruktiven Struktur.
Der wichtigste Förderer der französischen Strömung ist König Franz I. (1515-1547), der berühmt ist für seine Loire-Schlösser (Außentreppe am Schloss von Blois). Auch Madame de Rambouillet ist der neuen Kunst gegenüber sehr großzügig. Der König holt zahlreiche italienische Künstler nach Frankreich, doch ohne bleibenden oder durchschlagenden Erfolg. Schließlich lösen sich die französischen Kunsthandwerker vom Einfluß der italienischen Meister und entwickeln eigenständige Vorstellungen im Umgang mit der Antike. Die hervorragendsten Werke dieser Epoche in Frankreich sind der Hoch- und Spätrenaissance zuzuordnen, das beste und reinste Beispiel ist das Schloss Fontainebleau. Durch enge verwandtschaftliche und politische Beziehungen Spaniens mit Italien gibt es einen regen kulturellen Austausch mit diesem Land, daher wird die Renaissance in Spanien recht früh angenommen. Spanien schöpft aus seiner eigenen antiken Tradition, dem Maurischen; italienische Stilelemente werden nur adaptiert. Die spanische Spätrenaissance ist geprägt von der Regentschaft des König Philipp II. Seine tiefe und ernste Religiosität lehnt verspielte Ornamentik ab. Die Spanische Renaissance zeigt sich prägnant, männlich, streng, nüchtern. Bekanntestes Bauwerk: der spanische Königspalast in Madrid, der “Escorial“. Trotz intensiven geistigen und kulturellen Austausches deutschsprachiger Humanisten und Künstler mit Italien dringt das Formengut der italienischen Renaissance zunächst nicht in unsere Länder vor, deren Kunst noch von der Spätgotik bestimmt ist. Der wohl entscheidende Vermittler zwischen traditionellem Handwerk und neuen Kunsttheorien ist Albrecht Dürer. Seine Venedigreisen und die Handelsbeziehungen der Nürnberger und Augsburger Patrizierfamilien geben den Anstoß für die zaghafte Verwendung vor allem norditalienischer Elemente. Für Nürnberg ist in erster Linie Peter Flötner als hervorragender Möbel-Baumeister zu nennen, für Augsburg Hans Burgmair und Daniel Hopfer. Die nur zögernde Aufnahme des neuen Stils ist durch die religiösen und politischen Umwälzungen im nördlichen Europa zu erklären. Erst nach 1530 gewinnt die Renaissance im deutschsprachigen Raum an Boden, allerdings als durchaus eigenständige Entwicklung. München, eine Hochburg der Gegenreformation, spielt in der deutschen Renaissance eine besondere Rolle.
Exzellente Renaissancewerke finden sich in den Niederlanden. Außer Italien hat sich wohl kein europäisches Land so aktiv, kreativ und offen mit der Renaissance auseinandergesetzt. Für die holländischen Künstler ist die Natur der Führer. Man konzentriert sich auf die realen Dinge der Welt, zeichnet und malt mit mikroskopischer Genauigkeit. Die niederländische Kunst hat zwei Höhepunkte: den Ausdruck religiöser Gefühle und die Wiedergabe der den Menschen umgebenden, realen Natur. Zunächst ist Brügge das Zentrum im 15. Jahrhundert, im 16. Jahrhundert übernimmt Antwerpen die Vorherrschaft. Besonders starken Einfluß auf den norddeutschen Raum bis nach Frankfurt und Prag übt der flämische Architekt und Maler Hans Vredemann de Vries. Seine Vorlagen-Blätter zur Möbelgestaltung finden große Verbreitung. Geistiges und formales Gut aus Italien gelangt durch italienische Wanderkünstler über Ungarn nach Böhmen, Polen und Russland.
Möbel und Einrichtung
Die deutschen Möbel der Renaissance erreichen um 1500 einen Höhepunkt technischen und künstlerischen Könnens. Konstruiert sind sie hauptsächlich als Kastenmöbel. Die Möbelschreiner beherrschen die Kunst des Schnitzens und der Intarsienarbeit meisterlich, so dass aus dem tektonisch schlichten Einrichtungsgegenstand oft genug ein kleines Kunstwerk wird.
Die Wände des Patrizierhauses sind holzgetäfelt. Die häufigsten Holzarten hierbei sind Eiche oder gebeiztes Fichtenholz, Nussbaum noch recht selten. Den gewünschten Farbton erreicht der Kunsthandwerker, indem er das Holz mit heißem Sand bearbeitet. Diese Wandverkleidung reicht nicht immer bis zur Decke und ist reich dekoriert mit dem neuen Formengut. Symmetrisches Linienspiel dient der Flächenbelebung. Größere Flächen werden vielfach ein- und unterteilt durch Intarsien in geometrischen Grundformen. Echte oder simulierte Wandschränke sind in die Paneele eingearbeitet. Der obere, freie Wandstreifen ist entweder nach italienischem Vorbild mit Gemälden geschmückt oder einfach freigelassen, was besonders für die Nürnberger Renaissance typisch ist. Im Lauf der Jahrzehnte reichen die Täfelungen bis zur Zimmerdecke.
Die obere Zone der Verzierungen ist mit im Scheitel unterbrochenen Bogenfeldern auf kleinen Pilaster gegliedert, die Basis bilden gedrungene Voluten. Später ziert auch geprägte Ledertapete den Raum. In die Täfelung eingelassen ist eine von Säulen eingerahmte Tür, deren Abschlussgebälk schlicht sein kann oder mit einer Bekrönung aus dem Bereich der Pflanzenwelt versehen ist wie Girlanden, Rosetten, Akanthusblatt oder Fruchtreihen. Ähnlich ist die Fensternische gestaltet, in deren Öffnung Butzenscheiben eingesetzt sind.
Von der Zimmerdecke hängen verschieden gestaltete Beleuchtungskörper. Bis heute erhalten hat sich der Kronleuchter, ein Kranz oder Reifen, auf den Kerzen gesteckt werden. Sehr modern ist das Lüsterweibchen. An einer von der Decke herabgelassenen Kette ist eine, oft nackte, weibliche Figur befestigt, oftmals aus dem Bereich der Fabel, an der ein Hirschgeweih montiert ist und deren Arme als Kerzenhalter dienen. Der dritte Lampentyp ist die sogenannte “Flämische Krone“, aus deren zentralem vasenförmigen Metallkorpus Messingarme ragen. Darauf werden Kerzen aufgesetzt. Dem Renaissance-Menschen ist auch der Wandleuchter bekannt, der mit Vorliebe aus Reh- oder Hirschgeweihen hergestellt wird. Im deutschsprachigen Raum ersetzt der Kachelofen den offenen Kamin. In dem derart ausgestalteten Zimmer stehen die Möbel als Raumschmuck.
Ein wichtiger Einrichtungsgegenstand ist der Schrank. In der offenen Version heißt er “dressoir“ (dresser, franz.: anrichten). Er ist im Haushalt des 16.Jh, ein gefragtes Repräsentationsmöbel. Kostbare Geschirre und silberne Behältnisse werden darin aufbewahrt und zur Schau gestellt. Kaum ein Teil dieses Prunkmöbels ist ohne Schnitzerei, gestaltet aus allen Elementen der Renaissance: Löwenklauen, Beschlag, Rollwerk, Grotesken, Akanthus, Fruchtgehänge, Rosetten, Palmetten, Blattranken, Voluten, Karyatiden.
Beim Schrank wird der geschlossene Sockel als Schublade genutzt, den oberen Abschluss ziert häufig ein Fries mit antikischer Ornamentik oder ein Dreiecksgiebel. Profilierungen, Kehlungen, Verkröpfungen werden im Lauf der Zeit kräftiger, und den struktiven Aspekt stärker hervortreten zu lassen. Die Front und Seiten ziert das außerordentlich vielgestaltige Schmuckwerk aus den oben erwähnten Ornamenten sowie Muscheln, Löwen, Engelsköpfe, Masken, Vasen, Kartuschen.
Eine wichtige Rolle bei den Renaissancemöbeln spielen auch verschiedenste Pflanzenmotive und Vorlagen aus der mythologischen und biblischen Figurenwelt. Selbst das reichste Ornament ist Bestandteil oder Verstärkung des Aufbaus, beides ist sehr eng zu einer harmonischen Gesamtwirkung verbunden. Zunächst sind die Säulen glatt, dann werden sie üppig mit Reliefs überzogen, später intarsiert, die Kapitelle sind reich gestaltet. Eiche und Fichte verarbeitet der Möbelschreiner am häufigsten, das Modefurnier ist Esche. Mit der Eroberung der neuen Welt wird das kostbare Ebenholz sehr gefragt. Im Fortgang des Jahrhunderts werden die für die Architekten geschaffenen Musterbücher verbindlich für den Schreiner, der nach diesen Vorlagen die Fassade seiner Möbel gestaltet. Die klassische Ordnung der Säulen und Pilaster bestimmt den Aufbau des Möbelstücks. Füllungen mit Dreiecksgiebeln, die kleinen Tempeln gleichen, betonen nun die Front von Schrank und Truhe. Da hinein gefügt sind perspektivische Einlegearbeiten oder Reliefschnitzerei.
Die Kastentruhe ruht meist auf einem geschlossenen Sockel. Die Front ist wie beim Schrank gestaltet, aufgelockert in der Art einer architektonischen Fassade mit Bogenfeldern zwischen Pilastern. Die Felder sind mit Reliefschnitzerei geschmückt, später tritt üppige, phantasievolle und äußerst kunstfertige Intarsienarbeit an deren Stelle, häufig gefertigt in der neu entdeckten Kunst der Perspektive. Der Rahmen ist flach oder reliefiert geschnitzt, die Vertikale durch Säule und Pilaster zusätzlich betont.
Abbild menschlichen Tuns und menschlicher Kunstfertigkeit ist der Kabinettschrank. Der querrechteckige Schreibkasten birgt hinter der herabklappbaren Vorderseite eine kaum auszuschöpfende Vielfalt von Schubladen, Türchen und Geheimfächern. Der Kasten wird beliebig auf einen Tisch gestellt, ist also ein mobiles Möbel; später wird das spanische Untergestell Mode, ein Gestell mit Korkenzieherbeinen und Querverstrebungen, auf dessen oberen Rahmen der Schreibkasten gesetzt wird.
Auch das Pultkästchen oder –schränkchen mit seinen reich intarsierten Sichtseiten wird ähnlich verwendet. Prunkvoll und kostbar wird der Kabinettschrank durch die Verarbeitung von Ebenholz und aufwendigstem Gegenfurnier auf den Innenseiten von Türen und Klappen. Der Möbelschreiner dekoriert das wertvolle Ebenholz oft mit virtuosen Gold- oder Silberintarsien. Sehr anziehend, jedoch viel strenger wirken feine Einlagen aus geritztem Elfenbein.
Erst in der zweiten Hälfte des 16.Jahrhunderts werden Tisch und Stühle als Einrichtungsgegenstand unentbehrlich. Der feststehende Tisch zum Essen, zur Unterhaltung, auch zum Arbeiten und Lesen wird bei uns geläufig, während er im Italien der Frührenaissance schon stark verbreitet ist. Die beiden gängigen Typen sind der Wangen- und der Schragentisch. Die beiden Tischtypen sind seit der Spätgotik bekannt.
Beim Wangentisch ruht die Platte auf zwei seitlichen, meist senkrecht stehenden, massiven Brettern, den Wangen, deren Unterteile wie Kufen aussehen. Der breite Rahmen bekommt später reliefgeschnitzte Füllungen, in denen Schubladen verborgen sein können. In der Frühzeit der Renaissance sind auch steinerne Tischplatten beliebt, deren Oberfläche dekorativ geritzt und geätzt ist.
Das Gestell des Schragentisches besteht aus schräggestellten, meist scherenartig, verbundenen Hölzern unter den Seiten der Platte. Diese sind häufig geschweift. Die “Schragen“ genannten Beine sind üblicherweise mit einer Querverstrebung stabilisiert. Nun wandelt der Künstler die Gestelle ab, indem er z.B. die Beine pilaster- oder säulenförmig mit üppigen Kapitellen ausbildet. Dann verändert sich der Säulenfuß. Er wird mehrfach gewulstet oder korkenzieherförmig gedreht. Oft verjüngt sich auch der Säulenschaft, er wird mit Hermen oder Karyatiden geschmückt. Wie der Kabinettschrank entwickelt sich der immer beliebter werdende, runde oder quadratische Tisch zu einem veritablen Prunkmöbel. Auf der Tischplatte und später auch am Gestell zeigt der Kunsthandwerker all seine Fähigkeiten im Bereich der Intarsienarbeit. Fünferlei Holzarten und Elfenbein werden zu Intarsien verarbeitet. Die Findigkeit scheint kaum Grenzen zu kennen: der Klapptisch und der Ausziehtisch halten Einzug im Patrizier- und Fürstenhaus. In der Spätrenaissance deutet die Entwicklung des Tisches stark auf die Entwicklung des barocken Punktisches hin.
Der Stuhl erfährt nachhaltige Veränderungen. Denn zu den nun oft genutzten Tischen müssen neue Sitzgelegenheiten entworfen werden. Schon im 15.Jh. wird er Falt- und Klappstuhl in unseren Raum eingeführt, der aber nur für den aktuellen Gebrauch aufgebaut wird. Der bis dahin nur der Obrigkeit vorenthaltene Sessel findet als repräsentatives, bequemes Möbel seinen Einzug in die Räume des Patriziers. Das Gestell ist oft noch vom antiken Scherenstuhl abgeleitet, dessen X-Form jetzt immer öfter von vollplastischen Figuren verdeckt ist. Aus den Rückenlehnen mit Kandelabersäulen ragen reich geschnitzte, offene Armlehnen hervor, die in Voluten oder mythologischen Köpfen münden. Diese Art von Stuhl hat ein Lederband oder eine voll ausgebildete Rückenlehne. Denn mittlerweile hat man gelernt, Polster und Rahmen fest miteinander zu verbinden. Die Bekrönung des Lehnenrahmens entspricht in ihrer Ornamentik den obigen Beschreibungen.
Der Armlehnstuhl erhält ein vierbeiniges Gestell, das gerade und rechtwinklig ist. Die Beine können schmucklos und vierkantig sein, aber auch säulenförmig und münden in Tatzenfüßen oder wie die Armlehnen in Voluten oder Tierköpfen. Die vorderen Beine stützen die Armlehne, die rückwärtigen umrahmen die Rückenlehne und haben an ihrem oberen Ende Karyatiden, die in Schnecken oder Tierhäuptern münden. An der Schauseite des Gestells und der Lehne verlaufen häufig recht breite, stabilisierende Bretter, die reich geschnitzt und verziert sind.
Selbstverständlich gibt es auch den Brettstuhl. Dessen Holzsitz, der in jedem Fall eine geometrische Form bildet, ruht auf vier eingepflockten, schräggestellten Beinen. Die mit einem Greifloch versehene Rückenlehne ist reich verschnitzt.
Auch das Bett ist in seiner Grundstruktur ein Kastenmöbel. Gewöhnlich wird es von einem Bildhauer entworfen. Der breite Rahmen ruht auf vier körperhaften Füßen, aus seinem oberen Teil ragen Säulen auf. Diese scheinen in ihren verschiedenen Formen den Tischbeinen zu ähneln. Auf den Säulen schwebt der Baldachin, der sich nicht immer über das ganze Bett spannt. Das Kopfbrett ist im Vergleich zum Fußbrett stark erhöht, alle Schauseiten des Bettes schmücken die Zierraten der Renaissance wie Pilastergliederungen, rustizierte Bögen oder Ädikulumfüllungen. Dazu gesellen sich Reliefschnitzereien und später Intarsien. Übrigens dient der Baldachin des Renaissance-Bettes keineswegs nur der Gemütlichkeit und der Intimität, vielmehr soll er den Schläfer vor herabfallenden Insekten schützen.
Im Zusammenhang mit dem Bett ist der Gießkalter zu erwähnen, ein in der Spätgotik modern gewordenes Waschkästchen. Die Deckplatte ist nach beiden Seiten hin ausklappbar, darin verbirgt sich das Waschgeschirr.
Wie sich Denken, Handeln, Gebäude und Möbel im neuen Geist wandeln, so wandelt sich auch die Kleidung. Zum neugestalteten Zimmer passt nicht mehr die anliegende, mittelalterliche Strumpfhose. Der Herr trägt jetzt eine monströse Pluderhose mit Betonung des Hosenlatzes. Diese Hosen sind rundum geschlitzt und mit andersfarbigen Stoffen unterlegt. Darüber kleidet man sich mit einem Wams, dessen Ärmel ebenfalls im oberen Teil geplustert sind.
Zunächst trägt der gehobene deutsche Herr noch halsfern, dann wird der Halsausschnitt mit einem kleinen Halstuch geschmückt. Dieses weicht dann dem Hemd mit weitem, spitzenbesetztem Kragen, woraus sich später die gestärkte Halskrause entwickelt. Den Kopf bedeckt ein breites Barett oder ein großer Federhut. Die Kleider der Damen werden ausladender, aus sich bauschenden Stoffen hergestellt. Die Taille rutscht wieder vom Busen an ihren natürlichen Ort, zunächst wird der tiefe, rechteckige Ausschnitt nach vorn von einem Hemd verdeckt. Darunter trägt die Dame das spanische Korsett, eine für unsere Verhältnisse unvorstellbare Monströsität aus Eisen, Bein und Bändern. Der Brustlatz ist üppig verziert, darüber hängen mehrere Ketten aus Gold und Perlen, die Hände sind geschmückt mit köstlichen Ringen. Später werden Stehkragen und Coller modern. Frauen wie Männer tragen die breiten “Kuhmaulschuh“ aus Stoff oder Leder. Man war üppig in der Kleidung, über Samt, Damast und Brokat trägt man Marderpelze.
Eine auf Idealität und Ruhe ausgerichtete Kunst wird stets von jungen Kräften in Frage gestellt. Ab 1520/30 sind in Italien, bei uns gegen Ende des Jahrhunderts Anzeichen von Unruhe und Spannung zu beobachten, der Manierismus kündigt sich an. Der tiefgründige, geistige Symbolismus weicht einem ingeniösen Spiel allegorischer Zufälle. Der Mensch, das Ziel des Humanismus und der Renaissance, gerät wieder aus der Balance.
BAROCK
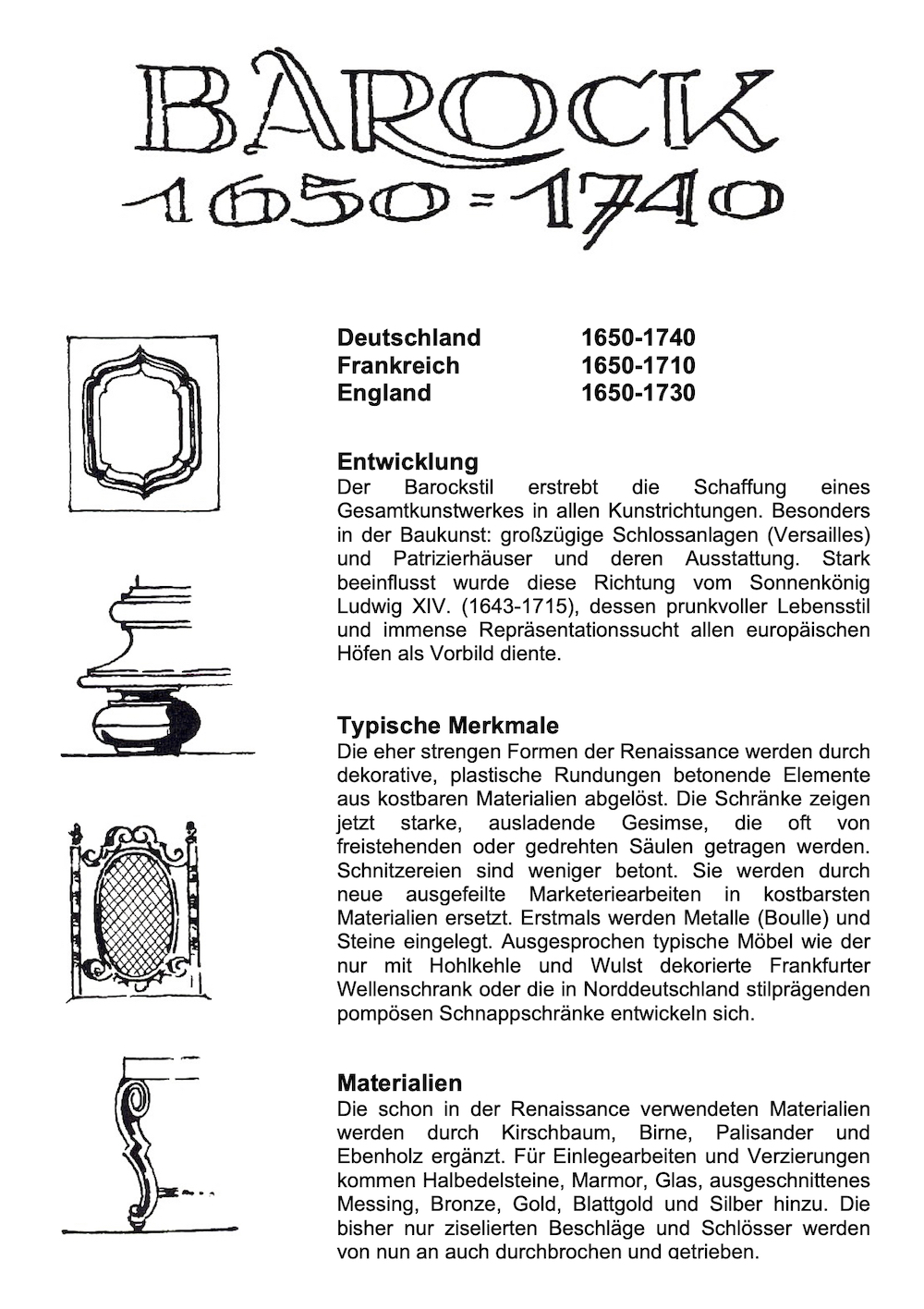
Das Wort “barock“ stammt aus dem Portugiesischen und bedeutet “unregelmäßige Perle“. Im Lauf der Jahrhunderte wird es in den französischen Sprachgebrauch übernommen mit der abgewandelten Bedeutung “sonderbar“. Wertfrei und als rein kunsthistorischen Begriff verwenden es erstmals Cornelius Gurlitt und Heinrich Wölfflin in der deutschen Kunstgeschichte (1888). Ausgehend von Italien kann die Kunst des Barock als Kunst der Gegenreformation bezeichnet werden. Obwohl das Barock das letzte gesamteuropäische Stilrichtung gilt, ist es sehr reich an national unterschiedlichen, eigenen Stilelementen. In Italien zum Beispiel tritt es als rein urbane Erscheinungsform auf.
Aus den klaren, ruhigen Formen der Renaissance entwickelt sich – für uns maßgebend – der Manierismus. Michelangelo ist wohl das berühmteste Beispiel für diese Entwicklung, indem er die klassische Bildkomposition aufgibt zugunsten wuchtiger Figuren und illusionistischer Architekturdarstellung. Ausgewogene Arrangements werden abgelöst von Kunstwerken, in denen Bewegung bis hin zur höchsten Dramatik ausgedrückt wird. Gleichzeitig tritt die Steigerung und Betonung der Mitte in den Vordergrund. Mit rauschhafter Hingabe werden Stilmittel eingesetzt wie Lichteffekte, Spiegel, Vergoldungen, Faltenschwünge, Girlanden, Wasserspiele. Scheinbare Unendlichkeit vermittelt übersinnliche Dimensionen. All die schwelgerischen, illusionären Effekte sind nur durch den Einsatz ihres Widerparts möglich, nämlich durch die moderne Mathematik und Geometrie. Beispielgebend sind Sakralbauten, die von konservativen, gegenreformatorischen Kräften in Auftrag gegeben werden; Johann Sebastian Bach führt mit seiner Musik einen lebenslangen Kampf gegen seine Kirchenoberen, denen seine Musik zu “opernhaft“ ist – jedoch für uns heute der Inbegriff “mathematischer Musik“.
Der Barockmensch – erschüttert durch die Zerrüttung des Weltbildes seiner Vorfahren – baut sich mit Hilfe von Formeln und Formen eine Art Bühne, auf der er sich selbst zur Schau stellt. War die Renaissance noch gebändigte Vernunft, entfaltete sich die Vernunft am Ende des Barock als ungebändigte Weltlichkeit. Unter der prunkvollen, gezirkelten Äußerlichkeit schwelt noch die Grausamkeit der düsteren Vergangenheit. Es ist noch ein weiter Weg bis zur Verweichlichung des Rokoko-Menschen.
Das Barock kann als Tat europäischer Fürsten betrachtet werden. Während sich die Mitte Europas im letzten großen Religionskrieg (1618-1648) zerfleischt, keimt rundum die Neue Zeit. Europa gründet weltumspannend, nach der Weltentdeckung kommt die Welteroberung mit Sklavenhandel und Kolonisierung: 1618 gründet sich die englische Westafrika-Kompagnie, 1619 gründet die Niederländische Ostindische Kompagnie die Stadt Batavia (Djakarta) auf Java, 1626 gründet sich die Französisch-Westafrika-Kompagnie; 1619 gründet Virginia das erste moderne Parlament, 1620 gründen die “Pilgrim Fathers“ die Kolonie “New England“ in Nordamerika, Madras wird als englische Siedlung in Indien gegründet (1659-1752 Hauptsitz der Ostindischen Handelsgesellschaft). Gründen, gründen, gründen, ...
Obwohl europaweit absolute Herrscher den Gang der Geschichte bestimmen, ist für den Gebildeten Europa geeint (Voltaire am preußischen Hof, Holbein und Händel am englischen Hof, Zar Peter der Große unternimmt eine Europareise.
Absolutismus ist der endgültige Sieg des Weltlichen über die Kirchenmacht. Während Habsburgs Traum einer “Civitas Die“, eines umfassenden Gottesstaates, zerbricht, legen die Randstaaten der Habsburger die Fundamente für künftige Weltgeltung: Schweden, Preußen, die Niederlande; und Frankreich, der alte Gegner Habsburgs, blüht zu größter Geltung empor. Kardinal Richelieu und sein Nachfolger Mazarin verzichten auf kirchliche Machtausweitung: die beratende Lenkung weltlicher Macht gibt ihnen mehr Einfluß als der Papst je hatte. Und noch während unter ihren Fittichen sich der kommende Stern unter den absolutistischen Herrschern entwickelt, macht Cromwell in England seine Charles I. um einen Kopf kürzer. Auch Könige sind sterblich.
Am Anfang des Barock steht noch der Versuch, christliche Weltdeutung krampfhaft aufrechtzuerhalten, am Ende gilt das neue Lieblingswort der Epoche “Fortschritt“.
Unsterblich scheint Ludwig XIV. von Frankreich zu sein. Seine Wirkung, sein Stil, sie werden unvergänglich. Er spielt mit seinem hervorragenden Kunstverstand die wichtigste Rolle unter den Fürsten Westeuropas. Er eint die widersprechenden Stilelemente des italienischen Barock mit denen der französischen “clarté“ und prägt so den europäischen Geschmack: Bernini, der “Papst“ zeitgenössischer Künstler, wird nach Paris eingeladen, um den Louvre umzubauen. Unter dem Vorwand, seinen prächtigen Plänen mangele es an häuslicher Hygiene, muß er wieder heimkehren. Stattdessen konzentriert Ludwig alle Kräfte auf Versailles, wo eine unvergleichliche Pracht künstlerischer Blüte sich entfaltet.
In Deutschland findet zunächst nur der katholische Süden Geschmack an den revolutionierenden Anregungen aus Italien. Der protestantische Norden verharrt weitaus länger in den ruhenden, kargen, sachlichen Dimensionen und Proportionen der Renaissance. Die Zerstörung Mitteleuropas durch den Dreißigjährigen Krieg setzt – welchen künstlerischen Neigungen auch immer – ein schreckliches Ende. Erst das 18.Jh. zeigt die besondere Blüte des deutschen Barock, ausgehend von Österreich und Böhmen.
Weiter im Norden – in England – ist der Renaissancestil unverhältnismäßig lange tonangebend. Es ergibt sich nur ein kurzes Techtelmechtel mit dem italienischen Barock. Inigo Jones trifft in Italien auf die Architektur Andrea Palladios, des großen Repräsentanten der klassischen Bauweise, und exportiert die Architekturtheorie der Antike nach England. Von dort greift der “Palladianismus“ auf das protestantische Holland über. Englands zweiter großer Baumeister, Sir Christopher Wren, (St. Paul´s Cathedral, London) reist nur bis Paris, um sich Impulse zu holen. Mit dem Tod Ludwigs XIV. geht in Frankreich die alte Welt des prunkvollen Barock unter.
Der Absolutismus hat der konfessionellen Zerfleischung Europas ein Ende gemacht. Der Mensch zieht die Diktatur dem Chaos vor. Er wird durch die Verrückung der kosmischen Ordnung zum Individuum – Aufbruch zur Moderne. Mit der Ausbreitung der Vernunft wird ein Weg beschritten, auf dem es keine Rückkehr mehr gibt und der in der französischen Revolution mündet.
Die politische Verstümmelung Deutschlands im 17. Jahrhundert ist verhängnisvoll – für die künstlerische Entwicklung hingegen ist sie fruchtbar. Denn jeder kleine Fürstenhof hält sich nun seine Künstler. August der Starke von Sachsen ist gewiss der bekannteste Herrscher, der absolutistische Machtfülle mit Kunstverstand und erlesenem Geschmack eint.
August der Starke
Nach einer großen Kavalierstour durch Europa kehrt er als virtuoser Kenner und großzügiger Förderer der schönen Künste an seinen Hof zurück. Obwohl Ludwig XIV. sicher sein Vorbild ist, holt der spätere polnische König, ein prachtliebender Mann von beinahe genialer Intelligenz, deutsche Künstler nach Sachsen. Matthias Daniel Poeppelmann baut für ihn den Dresdner Zwinger, der einem “Festsaal unter freiem Himmel“ ähnelt. August fördert Joh. Friedr. Böttger, den Nestor der späteren königlichen Porzellanmanufaktur in Meissen, die von anderen deutschen Fürsten eifersüchtig beäugt und nachgeahmt wird.
Obwohl Frankreich nach dem 17. Jahrhundert in Geschmack und Lebensweise tonangebend ist, kann man mit Fug und Recht vom deutschen Barock als einem eigenständigen Stil sprechen. Im Vergleich zu Frankreich weist Deutschland von Stadt zu Stadt, von Residenz zu Residenz, von Land zu Land einen außerordentlichen Variantenreichtum auf. Insofern ist es ausgeschlossen, an dieser Stelle auf die vielfältigen, differenzierten Stilmerkmale der verschiedensten Produktionsorte oder gar Produktionsstätten im Detail einzugehen. Der Verfasser beschränkt sich auf einige wichtige Schwerpunkte, die für das deutsche Barock Bedeutung erlangt haben.
Möbelstil – allgemein
Gegen Ende des 16. Jahrhunderts mehren sich in Deutschland die Anzeichen einer ungraziösen Verwilderung der Renaissance-Ornamentik. Der manieristische Schwulst Italiens feiert wahre Orgien. Etwa um 1610 tauchen statt der bisher üblichen architektonischen Säulen- und Musterbücher die ornamentalen Zieratenbücher auf. Mit ihnen kündigt sich das Barock an. Die neuen Ornamente bestehen aus einem leichter werdenden Schweifwerk, der knorpelige Ohrmuschelstil breitet sich aus. Perspektivische Kunstgriffe vermitteln Großräumigkeit. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts dringt die holländische Vorliebe für Blumen und Fruchtgehänge ins deutsche Barockdekor ein. Dazu gesellt sich später die alles überwuchernde Akanthusranke. Das Akanthusblatt entwickelt sich massig, lockenartig als Bekrönung oder Friesornament an Schränken, Betten, Tischen, Stühlen.
Im Verlauf des Jahrhunderts emanzipiert sich Deutschland vom italienischen Einfluß, Elemente der Spätrenaissance werden verinnerlicht und verstärkt. Unser Sprachraum hat mit schweren Problemen zu kämpfen, denn der dreißigjährige Krieg hat das Land fast ausgeblutet. Danach herrscht an allen deutschen Fürstenhöfen das Bestreben, die neu erblühende Macht und Pracht mit Hilfe der neuen Geschmacksrichtung darzustellen, während die Vorrangsstellung Deutschlands in den dekorativen Künsten, bedingt durch den langen Krieg, auf Paris übergegangen ist. Dort herrscht der jugendliche König Ludwig XIV. Trotz des ungeheuren Einflusses des Monarchen und der mannigfaltigen Impulse, die von seinem Hof ausgehen, werden diese in Deutschland nur zögernd angenommen. Im deutschen Barock halten sich – je nach dynastischen und konfessionellen Bindungen – französische, italienische und niederländische Anregungen die Waage. Zwar reizen die Versailler Entwürfe die deutschen Künstler; doch die meisten kunstliebenden Auftraggeber engagieren vorzugsweise italienische oder einheimische Kunsthandwerker. Aus Nürnberg werden nach ganz Europa die virtuosesten Kabinettschränke geliefert, in Augsburg übertreffen sich Gold- und Silberschmiede an Kunstfertigkeit und Einfallsreichtum.
Bei der Entwicklung des süddeutschen, höfischen Prunkmöbels ist Christoph Angermeier eine Schlüsselfigur. Prägend für das deutsche Barock ist Andreas Schlüter, der die Krönung seines Werkes in der Mark Brandenburg hinterlässt. Er gestaltet monumental-plastisch, liefert herausragende Beispiele des norddeutschen Barock. Sein Schüler Paul Decker wird zum bedeutenden Vertreter des Spätbarock; seine originellen, kraftvollen Skizzen sind leicht französisch beeinflusst, malerisch, dekorativ.
Der Entwurf der entstehenden modernen Möbel entspringt nicht mehr einer geistigen Haltung. Er ist das Anliegen von Schreinern. Sie heben das Holz in seinen ihm gemäßen Eigenschaften hervor. Sie nutzen all seine Möglichkeiten. Aus handwerklicher Erfahrung lassen sie in der Oberflächengestaltung Licht- und Schatteneffekte entstehen. Profilierungen und der Wechsel konkaver und konvexer Teile erhöhen die schmückende Wirkung des Möbelstücks. Aus kleinen, praxisbezogenen Schritten entsteht ein furchtbarer und entwicklungsfähiger Stil.
Durch die Weiterentwicklung des Werkzeugs (z.B. 1565 Erfindung der Ziehbank) erreicht die Kunst des Profilierens im Barock einen Höhepunkt und eröffnet neue Gestaltungsmöglichkeiten. Durch die barocke Flammleiste und ihre nahe Verwandte, die gewellte Leiste, werden die geraden Profile nun gewellt und bucklig. Das Fassadenmöbel ist noch mit Ädikulenfüllungen und kanellierten, korinthischen Säulen unterteilt. Verstärkte Rahmen, Säulen und Pilaster werden üppiger, Gesims Verkröpfungen mächtig. Hinzu tritt der Knorpel, eine wulstige Ornamentik, die Pflanzen und Fratzen durch ihre Verdickung und Betonung plastisch hervorhebt. Die Umrisse des strengen Renaissance-Schmucks weichen auf. Gleichzeitig mit der Knorpeltechnik entwickelt sich die Drechselkunst. Säulen und Möbelbeine können nun in unterschiedlichen Dicken gedreht werden. Die typisch barocke Balusterform mit ihrem länglichen oder kugeligen Korpus entsteht. Die so gedrechselten Säulen ergänzen die Knorpel an Füllung und Bekrönung harmonisch.
Ebenfalls zur Vervollkommnung gelangt die Kunst des Furnierens, der Intarsien und Marketerien. In ganz Deutschland ist, neben dem beliebten Ebenholz, Nussbaumholz auf dem Vormarsch, dessen warmer Braunton besonders geeignet ist für vielgestaltige Einlegearbeiten unterschiedlichster Techniken.
Innenausstattung
Die Wände des Barockzimmers sind in Füllungen eingeteilt, deren Felder plastisch dekoriert sind. Die Decken haben mächtige Hohlkehlen, sind mit Holzkassetten ausgestattet.
Später umrahmen kunstvolle Stuckarbeiten polychrome Deckengemälde, teils in Felder unterteilt, teils flächendeckend. Türen und die raumhohen Spiegel sind mit üppigen Blatt- und Fruchtwülsten eingefasst, über Kaminen und Flügeltüren türmen sich mehrfache Bekrönungen mit Medaillons und figürlichen Darstellungen, umgeben von Girlanden. Diesen Raumschmuck muß man sich in Stein, Metall, Holz, bunten Farben vorstellen, ab 1650 mit verschwenderischer Vergoldung.
Oberhalb der Täfelung werden immer häufiger dekorative Stoffe als Tapeten oder wertvolle Wandteppiche angeschlagen. Fenstervorhänge und Portieren aus Damast, Goldbrokat, polychromer Stickerei oder chinesischen Stoffen sind weit verbreitet. Herabhängende, elegant gefaltete oder geraffte Stoffbahnen werden luxuriös verziert mit Fransen und Quasten, später mit Rüschen und Schleifen. In diesen Räumen gilt Einheit und Repräsentanz, erreicht mit unterschiedlichen Mitteln und Bestandteilen.
Möbel – im Einzelnen
Ein wichtiges Möbelstück in diesem Ambiente ist der barocke Prunkschrein, von Fürsten und im kirchlichen Gebrauch verwendet. Dabei handelt es sich um ein zweitüriges Schränkchen, das immer auf einen Tisch gesetzt wird. Der Giebel ist getreppt gehöht, mit wunderbar reichhaltiger Bekrönung. Hinter den kleinen Türen verbirgt sich eine Unzahl von Schubladen, die eine in der Mitte befindliche Tür umgeben. Front und Innenseiten sind außerordentlich reich geschmückt mit allen denkbaren Barockelementen aus dem Bereich der plastischen Holzarbeit und der Intarsien. Oft sind diese beiden Techniken mit Gemälden verbunden. Im abschließbaren Sockel, der im Laufe der Zeit auf Volutenfüße gesetzt wird, ist fast immer eine Schublade untergebracht.
In Technik und Material ähnlich perfekt wie der Prunkschrein ist der Prunktisch. Seine – rechteckige, oktogonale oder runde – Platte ist stets aus kostbarem Grundstoff. Oft besteht die Platte auch aus poliertem Stein. Entweder ist sie mit virtuosen Intarsien aus Edelmetall oder Elfenbein verziert wie der Schrein, oder verschiedene Hölzer fügen sich zu delikaten Mustern. Modern sind auch Einlagen aus Stein (pietra-dura). Aus Florenz eingeführt wird die Kunst, holzfremden Schmuck in die Platte einzusetzen wie Marmorstücke und Halbedelsteine. Daneben verwendet der Künstler Emailarbeiten. Die vier Füße sind ebenfalls verziert, sei es mit Reliefschnitzerei, die später vergoldet ist, sei es mit Einlegearbeiten. Sie münden in einer Sockelplatte, die das Dekor der Tischplatte wieder aufnimmt.
Nicht zu verwechseln mit dem Prunkschrein ist der seit Renaissance bekannte Kabinettschrank. Auch er ein kleines, tragbares Möbel von unerhöhter Kostbarkeit und vielseitiger Verwendbarkeit, z.B. für die Aufbewahrung von Schriftstücken und Wertgegenständen. Der Kabinettschrank ist das Lieblingsspielzeug des Herrn von Welt bis zu Beginn des Rokoko. Der etwa einen Meter hohe, meist rechteckige Kasten mit abgeschrägten Ecken wird aus Ebenholz geschreinert. Anfangs ist seine Fassade noch mit vorgestellten Säulen und Pilastern gegliedert. Hinter den beiden Flügeltüren verbirgt sich ein kostbar gehaltener Mittelschrein, der als Schreibfläche, Toilettenspiegel oder Altar verwendet werden kann. An seinen beiden Seiten befinden sich Schubladen, hinter denen pfiffig angebrachte Behältnisse und Geheimfächer liegen. In den Anfängen ist der Giebel noch dachartig gehöht mit unerhörten Bekrönungen wie Spieluhr, Uhr, Figurinen. Die bekannten Beispiele dieser Möbelstücke zeigen in geöffnetem Zustand einen unvorstellbaren Reichtum an Material, Dekor und Formenvielfalt. Der Kabinettschrank hat immer einen passenden Tisch als Sockel. Er ist der Vorläufer des Schreibschrankes und des Schreibtisches. Gegen Mitte des Jahrhunderts wird das Kabinett höher. Über den eigentlichen Schrein wird ein ebenfalls von Säulen und Pilastern gegliedertes, sich verjüngendes Geschoss mit Schubladen gelegt, darauf sitzt die zierende Bekrönung. Der Kabinettschrank wird im Lauf seines Bestehens immer mehr zum ausgesprochen Schreib- und Arbeitsschrank, erfreut sich ungebrochener Beliebtheit bis weit ins 18. Jahrhundert hinein. Im süddeutschen Raum sind Augsburg, Prag und Böhmen die wichtigsten Herstellungszentren. Der Augsburger Kabinettschrank ist ein recht kleiner Ebenholzschrein mit köstlichen Gold-, Silber- und Steineinlagen; der böhmische ist größer, vorwiegend mit Steineinlagen. Wahrscheinlich ist Köln für den norddeutschen Raum der bedeutendste Produktionsort. Der niederdeutsche Kabinettschrank ist in der Architektur streng gehalten, karg im Umriss, das häufigste Einlegematerial ist Elfenbein, graviert wie Kupferstiche in ornamentalen und figürlichen Darstellungen; wie anderswo wird geschwärztes Holz verwendet, hier meist Birnbaum. Nur ganz hoch im Norden verarbeitet der Schreiner braunes Holz, aus dem geschnitzte Fassaden und Figuren herausgearbeitet werden.
In ganz Deutschland erlebt der Kabinettschrank während des Barock eine ungeheuer reiche Blüte. Das Aufsatzteil – das Kabinett – wird größer, das Breitformat wandelt sich in ein Quadrat, schließlich in ein Hochrechteck. Je nach Herstellungsart ist der Kabinettschrank reich geschmückt, wobei die Augsburger Mode (s.o., geschwärztes Holz mit Silbereinlagen) und der holländische Einfluß mit minutiösen Elfenbeinarbeiten tonangebend bleiben. Auch feinste Reliefschnitzerei und Reliefintarsien aus verschiedenen Hölzern dekorieren die Front, die Kunstfertigkeit erreicht ihren Höhepunkt. Damit wird die schwarze Farbe aufgegeben. Der Kasten steht oft auf einem Stollen-Gestell, das ebenfalls reich geschmückt ist. Um 1700 wird der Kabinettschrank vom Schreibtisch abgelöst, der zunächst noch einen dem Kabinett ähnlichen Aufsatz hat. Auf dem Gestell ruht ein Kasten, dessen Deckplatte zum Schreiben herausgezogen wird. Darüber erhebt sich der Aufsatz. Die Silhouette ist kantig und gerade. Dieser Möbeltyp erfährt manche Veränderung bis zur Entstehung des Schreibschrankes. In seinen Anfängen bildet ein Tisch das Unterteil, später rückt an seine Stelle die Kommode. Darauf erhebt sich ein Aufsatz mit Türen, Fächern, Schubladen.
Zu einem wichtigen Requisit des Barock wird der Kleider- und Wäscheschrank. Im bürgerlichen Lebensbereich wird er unentbehrliches Wohnmöbel, der Adel duldet ihn höchstens im Schlafraum oder auf dem Gang. Mit zunehmender Bedeutung des Schrankes degeneriert die beliebte Truhe der Vergangenheit – außer im bürgerlichen Bereich – zu einem Vorratsmöbel in den Dienstbotentrakten. Noch ist der Schrank oft zweigeschossig, viertürig, mit vorgesetzten Säulen oder Pilastern als Fassadenschrank gestaltet. Schwere, mehrfach profilierte Simse mit wuchtigen Kröpfungen schließen das frühbarocke Kastenmöbel nach oben ab. Das Dekor der Füllungen wird schweifiger, runder, an manchen ganz frühen, süddeutschen Schränken ist schon ein geschwungener Sims zu finden. Ab ca. 1640 wird immer häufiger der eingeschossige Kleiderschrank entworfen. Nussbaum löst in ganz Deutschland das beliebte Edelfurnier ab. Engelsköpfe, Fratzen, Muscheln, Obelisken, geschnitzte Voluten und Ranken bestimmen das Bild der Schauseite. In Süddeutschland tauchen die ersten stark bewegten Bekrönungen auf strengem Sims auf, ebenso gesprengte Giebel und Volutengiebel. Dazu gesellen sich elegante, schmale Pilaster. Die Säulen sind geflammt, gehobelt und gedreht.
Das Knorpelwerk ist im ganzen deutschsprachigen Raum zu finden. In Süddeutschland ist der sogenannte Ulmer Schrank weit verbreitet mit vorgestellten, gewundenen Säulen und häufig farbigen Einlegearbeiten. Der frühe, hessische Barockschrank weist als besondere Eigenart vertiefte Kassettierungen auf sowie eine geometrische Gliederung von Lisenen und Pilastern. Die Grenzen zwischen nord- und süddeutscher Ornamentik verwischen sich durch den Austausch von Wanderhandwerkern. In Norddeutschland hält sich hartnäckig die Vorliebe für Ebenholz. Zwar verbreitet sich die in Lübeck und Lüneburg gepflegte Intarsienkunst, sie tritt aber als Ziermittel hinter den Schnitzereien des Massivholzmöbels zurück. Trotz des Konservatismus im norddeutschen Raum setzen sich in der Schnitzarbeit figürliche und ornamentale Elemente von üppigem Reichtum durch: Hermen, Fratzen, Fruchtgehänge, Roll- und Kartuschenwerk werden immer plastischer, steigern sich zum malerischen und fantastischen Barock voller Bewegung.
In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts entsteht der Stollenschrank: Der mehrfach getreppte, gekehlte Sims ist wuchtig gekröpft, an den Seiten und auf der Front schwelgen üppige, kissenförmige Kassettenfüllungen. Drei gleichmäßig über die Schauseite verteilte schwere, korkenzieherartig gedrehte Säulen münden im Sockel. Dieser ist ebenfalls gekröpft, in seinen Füllungen sind Schubladen untergebracht. Dieses schwere Möbelstück steht auf überraschend unproportionierten, gedrechselten Ballenfüßen. Ein anderer Schranktyp ist der Schapp. An Stelle der Felder des Fassadenschrankes treten mächtige, erhabene “Kissen“, die Bossen, die aus mehreren aufgedoppelten Brettern bestehen. Die Verbreitung dieses ursprünglich niederländischen Stilelementes reicht von Hamburg über das Rheinland und Franken bis nach Danzig. Der mehrfach getreppte, gekehlte Sims ist wuchtig, gerade, seine Mitte schmücken üppige Reliefschnitzereien, meist aus Engelshäuptern, die von Fruchtgehängen, Roll- und Blattwerk umkränzt sind.
Der Spiegel der Kissen ist noch rechteckig mit Flammleisten an den Profilen, die kleinen Felder der ganzen Füllung reich geschnitzt. Im Lauf der Jahrzehnte laufen die Türfelder nach oben und unten spitz aus mit hochovalen Spiegeln, der Rahmen ist durch quergelegte Bänder und Blumenschnitzerei bereichert. Die erhabenen, in kunstvollen Profilen gefassten Spiegel sind umgeben von Schnitzerei, ebenso alle konstruktiven Teile. Blumen und Fruchtgehänge, dazu Akanthus sowie allerlei Figürliches sind die Motive dieser plastischen Schnitzarbeiten. Im Sockel passen sich zwei nebeneinanderliegende Schubladen ein, deren Front je eine querliegende Bosse ziert mit gezackten Profilen. Der Danziger Schrank ähnelt in seinen Grundelementen dem Schapp, jedoch ist sein Giebel trapezförmig, gebildet aus gerade laufenden, profilierten Schenkeln, während der ebenfalls sehr ähnliche Lübecker Schrank einen geschwungenen Abschluss hat. Das Holz der Wahl ist mittlerweile Nussbaum. Im Verlauf des 17. Jahrhunderts findet der Norddeutsche Kissenschrank in ganz Deutschland Verbreitung. Bis nach Bayern, wo er vorzugsweise zweigeschossig als viertüriger Wäscheschrank auftritt. Unentbehrlich ist in diesem Raum auch der zweitürige Gewandkasten. Die Säule wandelt sich im Lauf des Barock entscheidend. Sie kann durchgehend gerillt sein oder ist beinah knorpelig gedrechselt, neben der schon bekannten Spiralform als Leitmotiv. Dazu gesellen sich die schweren Frucht- und Blumengehänge und um die Jahrhundertwende das Akanthusblatt für den Schnitzdekor. Die Füllungen sind aufgedoppelt oder im Rahmen profiliert, häufig versehen mit perspektivisch-illusionistischen Holzeinlagen. Vorzugsweise wird Nussbaumfurnier verarbeitet. Im Frankfurter Raum tritt ein neues Element zu den bekannten Möglichkeiten: Kehle und Wulst treten in ein spannungsreiches Wechselspiel. Der Volksmund spricht dabei von Wellen, vom Frankfurter Wellenschrank. Damit ist der Fassadenschrank endgültig aufgegeben, der Schreiner verzichtet auf plastischen Schmuck zugunsten der dynamisch gestalteten Schauseite. Sie zeigt eine Aneinanderreihung von Wulst und Kehle, welche Bewegung und Lebendigkeit durch Licht und Schatten bewirkt. Der Frankfurter Schrank ist eingeschossig, flach schließend, mit waagerechtem oberem Abschluss. Im Lauf der Entwicklung dieses Möbeltyps weichen vorgesetzte Säulen und Pilaster ebenso wie das Schubladengeschoß im Sockel. Rahmenbau und der Rahmen der Füllungen werden flacher. Das Kranzgesims und später auch der Sockel sind stark profiliert. Im Lauf des 18. Jahrhunderts nimmt die Wulstung weiter ab, beschränkt sich schließlich auf den Rahmen. Durch das Abschrägen der Ecken wirkt der Korpus jetzt geschmeidiger. Der Frankfurter Schrank findet über das Rhein-Main-Gebiet hinaus starke Verbreitung bis nach Sachsen.
Beim Tisch setzen sich die neuartigen Formen am leichtesten durch. Beim Prunktisch bleibt zunächst die Steinplatte als Quadrat, Achteck oder Kreis mit der unverzichtbaren Bodenplatte. Am runden Holztisch kann man in Norddeutschland Segmente herabklappen, wodurch der Tisch sich zum handlichen Quadrat verkleinert. Die Vielfalt der Gestelle kennt keine Grenzen: Baluster-, Spiral- oder Scherenbeine; Figuren als Beine, Akanthusranken versehen mit den dekorativen Elementen der Groteske. Fast immer sorgen Verstrebungen für die nötige Stabilität. Eine Sonderstellung nimmt der Prunktisch ein, dessen Platte nach 1700 in Bouille-Technik verziert ist. Getöntes Horn, Schildpatt, Messing und Zinn verschmelzen zu filigranen, flächendeckenden Zierfeldern, die Mitte der Platte ist aus pietra-dura.
Aus dem Tisch mit seinem immer barocken werdenden Gestell entwickelt sich der Konsoltisch, dessen tragende Teile in Akanthusranken, Fratzen, Putti ausgebildet werden. Er steht immer an der Wand. Über der Konsole hängt als Raumschmuck ein hochrechteckiger Spiegel, dessen Rahmen über und über verziert und vergoldet ist. Eine niedliche und nützliche Variante ist der Gueridons, ein stummer Diener, der als Leuchtertischchen dient. Leicht beweglich versorgt er den Raum mit zusätzlichen Beleuchtungsquellen. Sein Schaft – gewunden, balusterförmig gedreht oder figürlich geschnitzt – mündet in einem getreppten Scheibenfuß oder einem Sockel. Zierlicher wirkt der spätere Pilasterfuß mit Intarsienarbeiten – bewegt wirkt er, wenn er aus vollplastischen Akanthusranken besteht.
Der Sitzmöbel behält man so bei, wie sie seit Beginn des Barock geschaffen wurden. Nur am Dekor lässt sich zunächst eine zeitliche Zuordnung treffen. Der Scherenstuhl mit Armlehnen ist weit verbreitet, er bleibt in seiner Grundform altertümlich; Rahmen, Lehnen und Beine werden mit schwerem Akanthus, Tierköpfen und Tatzenfüßen verschnitzt. Im Verlauf der Epoche verbreitert sich der Sitz, der Mittelsteg der Lehne wird gepolstert, daher bequemer, das Gestell figürlich ausgebildet. Schließlich verändern sich die Proportionen, der Umriss des Stuhles erscheint schlanker und höher. Da die reifberockten, hochfrisierten Damen nicht bequem sitzen können, erreichen die Rückenlehnen von Sitzgelegenheiten eine beträchtliche Höhe, das Gleiche gilt für den Sitz (Höhe bis zu 60 cm). Das Mittelfeld der Lehne ist gern nach englischem Vorbild geflochten. Die Ranken oder Akanthusschnitzereien gehen in die gedrechselten Seitenholme über. Ebenfalls aus England kommend, verbreitet sich die Vorliebe für massives Nussbaumholz. Von den Spaniern übernimmt man die Vorliebe für Polster- und Abschlussnägel aus Messing. Das Scherengestell wird gänzlich aufgegeben.
Auf den stollenartigen und später schwergeschnitzten Beinen ruht die Sitzfläche, die dem Betrachter zugewandten Bretter an Gestell und Lehne sind üppig geschnitzt. Aus den schmucklosen vierkantigen Beinen entwickelt sich ein reich dekoriertes Gestell. Im Hoch- und Spätbarock wird der Schreiner oft zum bloßen Konstrukteur des Gestells degradiert, viel wichtiger ist der Tapezierer. Die Kunst des Schreiners beschränkt sich beim höfischen und großbürgerlichen Stuhl mehr und mehr auf die Bekrönung der Lehne, die reiche Ausbildung von Armlehnen und Beinen. Denn aus den spiralig gedrehten Säulen der Füße und Stegverbindungen werden dekorative Meisterstücke, die in Harmonie mit den kostbaren Bezugsstoffen leben. Zu der Vielzahl von Stühlen und Sesseln gesellt sich das Sofa, genannt Kanapee, ein doppelbreiter Sessel. In seinen Anfängen ist das ganze Gestell kunstvoll geschnitzt in Barockornamentik, schließlich wird die Rückenlehne höher und gepolstert. Dementsprechend zierlich fällt die Dekoration des Rahmens aus. Auch bei dieser Sitzgelegenheit wird der Polsterer wichtig wie der Schreiner. Brettstuhl, Schemel und Hocker bleiben in Form und Konstruktion nahezu unverändert, das schmückende Schnitzwerk an Lehne und Gestell verweist auf das Barock. Der Hocker – später mit gepolstertem Sitz – ist im höfischen wie im bürgerlichen Lebensraum zu finden, Schemel und Brettstuhl sind dem bürgerlichen bis bäuerlichen Bereich zuzuordnen. Der Nachtstuhl wird bei Fürsten und Bürgern gleichermaßen begeistert aufgenommen. Und er steht keineswegs nur an lauschigen Plätzen!
Das Bett ist ein zentraler Punkt im höfischen Leben. Es steht im salle de parade (Schlafzimmer, aber zugleich wichtiger Repräsentationsraum des Fürsten) auf einer Erhöhung, die alcôve heißt. Das Bett behält am längsten von allen Barockmöbeln die Kastenform, aus der die schweren Säulen aufsteigen. Auf ihnen ruht der Baldachin. Nur das neue Dekor lässt es barock wirken. Schließlich wird das Kopfbrett überproportional hochgezogen und prunkvoll geschnitzt oder eingelegt. Die Gesamtform bilden vollplastische Akanthusranken. Immer öfter nun wird der Tapezierer und Polsterer unentbehrlich für die Herstellung des Bettes. Denn dessen Holzgerüst verschwindet im Lauf der Jahre unter Vorhängen und Falten des Baldachin, und sein Kranz wird ebenfalls aus prunkvollen Textilien mit Fransen ausgeführt. Bett, Baldachin und Vorhänge verwachsen zu stilistischer Einheit. Als nächsten Schritt verzichtet der Schreiner auf die Stollen, der Baldachin wird zum Himmel, frei über dem Bett schwebend, unsichtbar an der Decke befestigt. Um das Bett herum sind “ruelles“ angebracht, kleine Räume für Besucher des Ruhenden, die durch Balustraden vom Bett getrennt sind.
Trotz der Rezeption ausländischer Einflüsse geht die künstlerische Entwicklung deutscher Möbel des Spätbarock eigene Wege. Religiöse und verwandtschaftliche Beziehungen der zahlreichen deutschen Höfe untereinander und zu anderen Kulturzentren bestimmen die Formgebung. Ebenso aber gibt es nach wie vor die Abgrenzung des süddeutschen vom norddeutschen Kulturraum. Im Norden leben die oben beschriebenen Möbel, besonders das Kastenmöbel, bis weit ins 18. Jahrhundert hinein weiter: Schapp, Stollenschrank und Frankfurter Wellenschrank. Lediglich die Proportionen ändern sich, die Schränke werden schmaler und wirken dadurch höher, einige Typen erhalten einen bewegt gestalteten Giebel. Die Beharrung im Alten betrifft den bürgerlichen Bereich. Die fürstlichen Möbel des Spätbarock nehmen den dominierenden, französischen Einfluß nach 1715 bereitwilliger auf. Das pathetisch Barocke wird überwunden, eine zurückhaltend klassizistische Komponente hält Einzug. Das vierkantige oder achteckige Bein wird steifer und gerade sowie balusterförmig, sich nach unten verjüngend. Die wichtigsten Möbel des 18. Jahrhunderts sind die Kommode und der Schreibtisch. Die Kommode kommt aus Frankreich, wird in Deutschland gern aufgenommen, bei uns hauptsächlich in dreischübiger Version. Wie der Konsoltisch steht sie ausschließlich an der Wand. In den zwanziger Jahren ist ihre Silhouette gerade, dann gerät sie in Bewegung, indem sie segmentförmig konkav oder konvex geformt wird, was zur Schweifung führt. Anfänglich versieht der Schreiner die Kommode gern mit einem Aufsatz aus vielen kleinen Schubladen, daraus entsteht der Aufsatzschrank. Ein enger Verwandter dieses Einrichtungsgegenstandes ist der oben erwähnte Schreibschrank.
Das wichtigste Stilmerkmal des Barock nach 1700 ist das rein dekorative Bandelwerk, ein aus abwechselnd gradlinig und rund umrissenen Bändern gebildetes Rahmenwerk. Seine phantasievolle Verwendung führt zu verschieden geformten Netzen von Zierfeldern, aus deren zarten Voluten elegant geschwungene Blätter lappen können. Holz- und Metallfurniere übernehmen das Bandelwerk ebenso wie die Kanten von Teppichen, es schmückt als Einlage die Schauseiten der Möbel. Dieses typische Barockelement ermöglicht eine reiche Vielfalt, ein abwechslungsreiches Spiel von geometrischen Formen, von figürlichen und pflanzlichen Darstellungen. Neben dem Bandelwerk und der oben erwähnten Boulle-Technik ist die wichtigste stilistische Neuerung des 18. Jahrhunderts die Schweifung und Bauchung von Möbeln. Auf diesen neuen Formen kommen die beliebte Vergoldung und die ornamentalen Beschläge am besten zur Geltung. Nicht vergessen werden dürfen die Chinoiserien, Lackarbeiten in chinesischer Technik. Durch die Eroberung fremder Erdteile halten deren Kulturen – abgeguckt und abgekupfert – als “dernier cri“ triumphalen Einzug im Salon des 18. Jahrhunderts. Diese Bearbeitungsweisen und die Boulle-Technik verleihen den Einrichtungsgegenständen des Spätbarock eine außergewöhnliche Grazie, Eleganz und Bewegtheit. Daneben bleibt die Intarsie das beliebteste Ziermittel der Kastenmöbel. Schnitzarbeit ziert hauptsächlich Konsoltische und Sitzmöbel aller Art. Das netzförmige Bandelwerk bildet einen idealen Hintergrund für virtuose Holzeinlagen und Marketerien, die immer reicher, zierlicher und bewegter werden. Neben Holz bleibt Elfenbein sehr beliebt für Intarsien, dazu treten Zinn, Perlmutt, gefärbtes Horn, seltener Silber. All diese Materialien sind vorzugsweise in Nussbaumfurnier verarbeitet, welches zum beliebtesten Holz des Barock geworden ist.
Abschließend verdient Erwähnung, dass man kaum von einem bürgerlichen Spätbarock sprechen kann, denn dem durchschnittlichen, bürgerlichen Barockmenschen fehlt die Rücksichtslosigkeit, mit der die Fürsten bei jeder neuen Mode ihre Räume “entrümpeln“ lassen. Und haltbar sind diese Möbel, wie man bis heute sehen und erleben kann.
ROKOKO
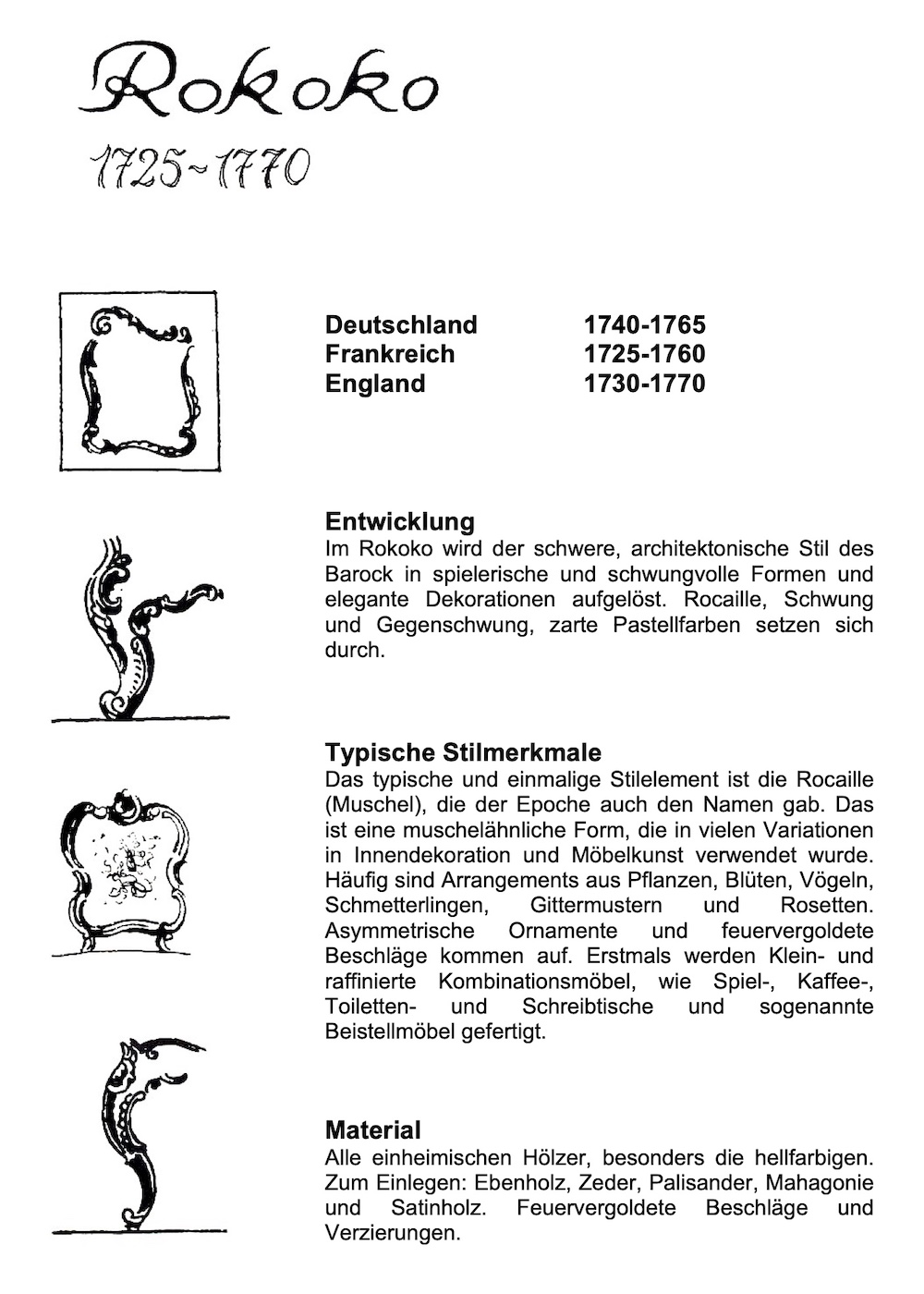
Die Zeit des Rokoko umfasst etwa sie Regierungszeit des französischen Königs Louis XV. (1723 – 1774), die Zeit des aufgeklärten Absolutismus. Das Wort Rokoko leitet sich aus zwei Wurzeln ab: 1. rocaille, franz. = Muschel, 2. rocca, ital. = Fels (als unregelmäßiges Gebilde) und wird als Stilbeschreibung benutzt wegen der Muschel, die das häufigste Schmuckelement dieser Zeit ist.
Das Rokoko geht von Frankreich aus und greift auf Resteuropa über. Es wird in Deutschland rezipiert, in Osteuropa findet es kräftige Verbreitung. England und Österreich reagieren auf die neue Strömung eher zurückhaltend, Spanien hingegen begeistert. In Süddeutschland geht die Entwicklung des Rokoko wohl am weitesten. Die künstlerischen Schwerpunkte liegen
a) bei den Fürstenhöfen
b) bei vielen Freien Reichs- und Hansestädten.
Die Zentren sind: Berlin, Dresden/Erfurt, Braunschweig, Norddeutschland, Aachen/Lüttich/Bergisches Land, Kurpfalz, Westfalen, Mainz/Frankfurt, Würzburg, Bamberg, Ansbach, Nürnberg, Württemberg, Hohenlohe, München.
In Vergleich zu den vorangegangenen Jahrhunderten finden wir im Rokoko ein Europa von relativer politischer Ruhe und Stabilität. Man könnte diese Ära des 18.Jh. auch als hohe Zeit von Staatsräson und Vernunft überschreiben; die Geschichtsschreibung spricht vom aufgeklärten Absolutismus. In Frankreich herrscht Ludwig XV., in England zwei hannoversche Georges, in Wien Maria Theresia, in Preußen Friedrich der Große, in Russland Katharina II.
Die gemeinsame Logik von Naturwissenschaften und Verstand scheint untrennbar, die Idee des Fortschritts scheint Gewissheit zu sein. Das politische Denken befindet sich in einem Reifeprozess, ein Vordringen des Prinzips der Rationalität in der Politik ist unverkennbar. Verallgemeinernd lässt sich sagen, dass sich zwei Rechtsideen gegenüberstehen: die des Gottesgnadentums und die des Rechts der Ständeversammlung, eines Rechts, das sich auf Vernunft begründet. Die Epoche ist gekennzeichnet durch umfassende Reformvorhaben im Bereich der Staatsverwaltung. Politisch und kulturell sind England und Frankreich die beiden europäischen Modellstaaten.
Gewerbe und Handwerk werden zahlreicher und vervollkommnen sich, bedingt durch die neuen Bedürfnisse des aufwendiger gewordenen Hoflebens. In England erleben Handel und Kolonien ein nicht zu bremsendes Wachstum; die industrielle Revolution kündigt sich an, Koksöfen und mechanische Webstühle werden in Betrieb genommen. Gleichzeitig ist der wachsende wirtschaftliche Wohlstand bestimmend für Wandel in Staat und Politik. In ganz Europa werden der politische Journalismus und die politische Karikatur Mode. Schriftsteller und Künstler lauschen am Puls der Zeit uns sind authentische Zeugen einer heraufkommenden Dämmerung. Der Kritiker mit der spitzesten Feder ist Voltaire, der schneidend und aggressiv die Praktiken der französischen Monarchie beschreibt. Recht früh vor der französischen Revolution sind die Zersetzungszeichen der festgefügten französischen Gesellschaftsordnung feststellbar. Obwohl Rousseau aufs Schärfste verfolgt wird, dringen seine Ideen bis in die obersten Schichten ein. Es entsteht eine Verfeinerung, aber auch eine Ermüdung der barocken Lebensform und damit verbunden auch der Dekoration einerseits; andererseits wird durch Zweifel am Sinn des barocken Pathos, die Annäherung an die idealisiert verstandene Natur und begreifende Vernunft immer stärker. Der Hof beginnt, die Etikette zu verneinen.
Obwohl England zweifelsfrei in Handel, Handwerk, Finanzwesen und Gewerbe eine unangefochtene Vorrangstellung in Europa genießt, verbunden mit einer vergleichsweise liberalen Monarchie, gilt das 18.Jh. als das Jahrhundert Frankreichs. Der südliche Teil Europas erliegt einem Frankreich-Kult, der Nachahmungstrieb in Bezug auf Politik, Zeremoniell, Architektur und Lebensart erreicht seinen Höhepunkt. Schließlich bleibt Französisch bis heute Diplomatensprache. Maria Theresia verheiratet ihre zahlreichen Kinder in politischen Ehen in fast alle europäischen Fürstenhäuser, der deutsche Hochadel tut´s ihr nach. Gleichzeitig entwickelt sich ein reger Austausch von Büchern, Zeitschriften, Hauspersonal, Künstlern und Handwerkern. Die Beweglichkeit der Menschen dieser Zeit nimmt zu, die Zirkulation von Wissen und Ware beschleunigt sich ungemein. Die "grand tour du cavalier“ führt zu lebhaften Anregungen in Geschmack und Technik. Der bis dahin vorgegebene soziale Rahmen wird durch größere Verbreitung von ideologischen und geistigem Rüstzeug aufgebrochen.
Gegen Ende des Rokoko beginnen die weltlichen und geistlichen Ordnungsgefüge zu wanken, die – grob gesagt – seit dem Mittelalter ihre Gültigkeit hatten. Die logische Folge sind gegen die Kirche gerichtete Reformen, die ihren Höhepunkt 1773 in der Aufhebung des Jesuitenordens finden. Schulen müssen schließen, Universitäten veröden. Schließlich ist Wissenschaft nicht mehr das Monopol der Geistlichkeit. Der Geist des Volkes, der Geist des Individuums stemmt sich gegen die Fesseln der tradierten Gefüge. Das eingespielte kulturelle und politische Leben befindet sich in einem unaufhaltsamen Wandlungsprozess, der allerdings noch recht verdeckt stattfindet. Diese Entwicklung jedoch ist nur eine Angelegenheit von Minderheiten wie Hochadel und Großbürgertum. Man lebt auf Vorschuss, noch einmal in aller Vielfalt genießen, ein Tanz auf dem Vulkan.
Das Rokoko wird unterschieden in höfisches und bürgerliches Rokoko. Das höfische geht aus vom katholisch-absolutistischen Paris mit Ausstrahlung, als Ideal und Vorbild, auf die absolutistischen Höfe Kontinentaleuropas. Dem gegenüber steht England mit seiner parlamentarischen Verfassung. England ist durch seine Kolonialpolitik offen für außereuropäische Einflüsse in der Kunst; die Folge ist eine lebhafte Bejahung amerikanischer und ostindischer Hölzer. Der Engländer schielt nicht so sehr auf die Gnade seines Königs, vielmehr gewinnen Reichtum durch Handel immer größere Bedeutung. Diese Entwicklung und Einstellung greifen aus geographischen und konfessionellen Gründen naturgemäß auf Holland und Norddeutschland über. Folgerichtig findet sich dort zunächst eine wenig repräsentative, vielmehr bequeme, wohnliche, gemütliche Version des Rokoko. Der Süden Deutschlands rezipiert später, jedoch viel intensiver, die höfischen Strömungen aus Paris. Währen in Frankreich der Absolutismus bereits lebhaft hinterfragt und kritisiert wird, erreicht er in Süddeutschland erst seinen Höhepunkt.
Die bürgerliche Möbelkunst gewinnt währenddessen als Gegenpol immer mehr an Bedeutung, bis sie schließlich das höfische Element dominiert. Bürgerlich heißt aber nicht für den Bürger, sondern es wird stilbildend von bürgerlichen Künstlern für Fürsten entworfen und konstruiert. Im Zenit des Rokoko wird die bürgerliche Handwerkskunst tonangebend. Zu einer Verschmelzung kommt es schließlich durch einen intensiven Austausch von Künstlern. Die bekanntesten Vertreter des bürgerlichen Rokoko sind die Brüder Roentgen, Cuvillies und Thomas Chippendale.
Ab 1750 ist eine bewusste Abkehr des Hofes vom Zeremoniell hin zum Lebendigen zu beobachten. Heitere, pastorale Sorglosigkeit verdrängt pompöse Etikette, freies Spiel der Phantasie angelehnt an die Natur (Schäferspiele) fragt nach varieté (Abwechslung), gaieté (Heiterkeit) und commodité (Bequemlichkeit). Madame Pompadour und später Marie Antoinette betrachten die Etikette als der Entfaltung hinderlich, Perücke und Reifrock werden kleiner.
Im Gegensatz zur schwungvollen, repräsentativen Formenergie des Barock ist das Rokoko in starkem Maße eine Kunst der Innenräume. Angestrebt ist eine innige Verschmelzung der Möbel mit dem Raum, das Möbelstück soll sich fließend in die Symmetrie des Raumes einfügen. Geraden und Ecken werden mehr und mehr aufgegeben, es entwickelt sich eine zunehmende Vorliebe für runde und ovale Kabinette, deren Decken und Wände reich mit Stuckarbeiten und Boiserien geschmückt sind. Zarte Farben und die abstrahierende Wirkung von Gold und Silber unterstützen den gewünschten Effekt.
An der Wand stehende Möbel werden mit konkav oder konvex geschweiften Fronten versehen, während die Seitenwände zur Zimmerwand hin breiter ausschwingen. Durch Schweifung der Zargen und der Beine in S- und C- Schwüngen verschmelzen tragende und nichttragende Teile zu ornamentaler Einheit, die durchgehende Silhouette bewirkt eine scheinbare Auflösung des Möbelstückes. Die Wohnräume werden kleiner und gemütlicher. Das fürstliche Schlafzimmer mit seinem bis dahin praktizierten “lever“ und “coucher“ verliert seine Bedeutung als repräsentative Bühne für die Demonstration des Gottesgnadentums. Schon die Änderung des Wortes vom “salle de parade“ zum “chambre á coucher“ gibt Aufschluss über den vollzogenen Wandel hin zum Legeren, Intimen. Bedingt durch die fortschreitende Differenzierung und Kultivierung aller Lebensbereiche verdanken wir dem Rokoko die größte Vielfalt im Bereich der Neuentwicklung von Möbeltypen.
Das kostbarste und prunkvollste Möbel ist das Schreibmöbel. Entwickelt aus Kommoden-, Pult- und zweitürigem Aufsatzteil finden wir den Tabernakel. Meisterlich furniert, ist seine Oberfläche geschmückt mit virtuoser Marketerie-Arbeit aus verschiedenartigsten Hölzern. Naturelemente wie Muscheln, Blüten und Zweige sind dafür die liebsten Vorlagen, später lösen sich die Rocaillen zu etwas Abstrakten auf, das die Herkunft der Muschel beinahe vergessen lässt. Dann gibt es den “bureau plat“, einen freistehenden Schreibtisch, dessen geschwungene und zierlich geschnitzte Zarge manchmal mit drei Schubladen versehen wird. Klein und elegant ist der Pultschreibtisch (Sekretär), dessen drei sichtbare Seiten ebenfalls köstlich dekoriert sind; vor neugierigen Blicken schützt eine Schrägklappe, später der Jalouise-Verschluss. Als Pendant zum Lieblingsmöbel des Herrn des 18.Jh. entsteht für die Dame das “bonheur du jour“, ein zierliches, gewitztes Schreibmöbel, das den Salon schmückt. Die Dame empfängt “en deshabillée“ in ihrem Boudoir ihre Kavaliere. Dort steht die besonders beliebte “poudreuse“, ein pfiffiger Toilettentisch mit dreiteiliger Deckplatte. Unter den zur Seite und nach hinten aufklappbaren Teilen verbergen sich in der Mitte der Spiegel und seitlich Versenkungen für Tiegel und Töpfchen. Auch das Geheimfach fehlt nicht. Als die Handarbeit für die Dame von Welt zur angemessenen Beschäftigung wird, kommt der Nähtisch hinzu, der meist überaus kostbar gearbeitet und mit allerlei technischen Finessen versehen ist. In allen Räumen stehen mit hellem Seidendamast bezogene, breite, bequeme Stühle mit niedrigen Lehnen. Ähnlich ist das Sofa gestaltet, auf dem mehrere Personen Platz finden; der Rahmen ist floral geschnitzt und manchmal in lichten Tönen gefasst.
Die repräsentativen Möbelstücke weichen mehr und mehr dem vielseitigen Gebrauchsmöbel: es entstehen Spiel-, Schreib-, Tee- und Lesetische, kleinere Tische für allerlei Verwendung, alles in köstlichster Verarbeitung. Die Tischchen stehen meist auf drei kleinen, geschwungenen Füßen, die manchmal mit feuervergoldeten, pflanzlich ornamentierten Beschlägen geschmückt sind.
In der Erfindung und Herstellung mobiler Einrichtungsgegenstände sind die Engländer besonders virtuos. Da das Bett jetzt in erster Linie zum Schlafen und nicht mehr zum Präsentieren fürstlicher Herrlichkeit bestimmt ist, rückt es aus der Raummitte mit seiner Längsseite an eine Wand. Es entstehen Nachttische, an denen der Jalousie-Verschluss den Nachttopf verbirgt. Die Kommode in vielen Spielarten erlebt ihre Blüte (commode, franz. = bequem). Sie entsteht aus der Truhe und der Konsole. Auch sie ist aufs Feinste furniert, mit geschnitzter Zarge.
Reich eingelegte, geschwungene Ecklisenen, die aber auch mit stark ornamentierten, feuervergoldeten Bronzebeschlägen geschmückt sein dürfen, gehen in die ebenfalls geschwungenen Beinchen über; Fronten, Seiten und Deckplatte der meist dreischübigen Kommode sind über und über dekoriert mit Marketerien aus Messing, Silber, Ebenholz oder den verschiedensten Obsthölzern; Front und Seiten sind mehrfach geschwungen. Der kleine einfüßige Tisch, “gueridons“, für Leuchter und Nippes ist sehr gefragt.
Die Hauptzerstreuung sind jetzt Kartenspiel und Musizieren. Daher ist die Entwicklung des Notenständers folgerichtig. Den großen, den Gesetzen der Raumarchitektur unterworfenen Wandspiegel löst ein kleiner, beweglicher Spiegel ab, darunter steht die über und über mit Rocaillen, Früchten, Zweigen und Blüten geschnitzte und gefasste Konsole. Auf Tischchen stehende Kandelaber weichen dem mit einem Wandleuchter fest verbundenen Spiegelblaker.
Die Philosophie bringt einschneidende Wandlungen. Revolutionierende Erkenntnisse auf dem Gebiet der Naturwissenschaft, Geographie und Technik brechen einer veränderten Geisteshaltung Bahn. Daraus entsteht unter anderem auch ein Naturalismus, der in der Dekoration von Möbel- und Kunstgewerbe seinen Niederschlag findet mit Motiven aus der Pflanzenwelt.
Später werden diese Ornamente auch in beinahe naturalistischen Farben gefasst. Dies ist besonders deutlich an den Stuckdecken von Rokoko-Gebäuden in Süddeutschland zu beobachten. Wenn Möbel farbig gefasst sind, dann in zarten Blau-, Grau- und Gelbtönen, in Gold oder Silber.
Wirklich bunt gefasste Möbel tauchen nur in der Volkskunst auf, die wir heute als Bauernmöbel bezeichnen. Recht spät tritt die Blumenmarketerie auf; die dafür verwendeten, zahlreichen Hölzer sind in recht natürlichen Farben gehalten. Besonders die deutsche Blumenmarketerie zeigt sich abwechslungsreich und phantasievoll in der Darstellung naturalistischer Motive. Ansonsten sind Marketterien stark vermischt mit Einlagen aus Elfenbein, Messing, Zinn; Boulle-Technik wird nur noch bei Prunkmöbeln verwendet. Die Holzmarketterie ist kunstvoll und von technisch höchster Delikatesse. Vielfältige Edelhölzer werden gebeizt, seltener bemalt. Die figürliche Darstellung der wiedergegebenen Pflanzen tritt in den Vordergrund. Das Kunstschreiner-Handwerk erreicht ungeheure Virtuosität und Perfektion.
Das Rokoko ist die Epoche der Lebensbejahung, der heiteren Sorglosigkeit, unter der Auflösung schlummert. Rationale und phantastische Elemente halten Einzug in den Alltag. Höchste Intelligenz und Formkraft finden ihre Entfaltung im Stilisierungstrieb. Alles verbleibt im Bereich der Anspielung, wird nur zitiert, in künstliche Formzusammenhänge gebracht. Symmetrie wird durch Rhythmus und Balance ersetzt, Leichtigkeit und Grazie heben Schwere auf. Die künstlerische Ekstase führt bis zur Auflösung im Abstrakten.
LOUIS SEIZE
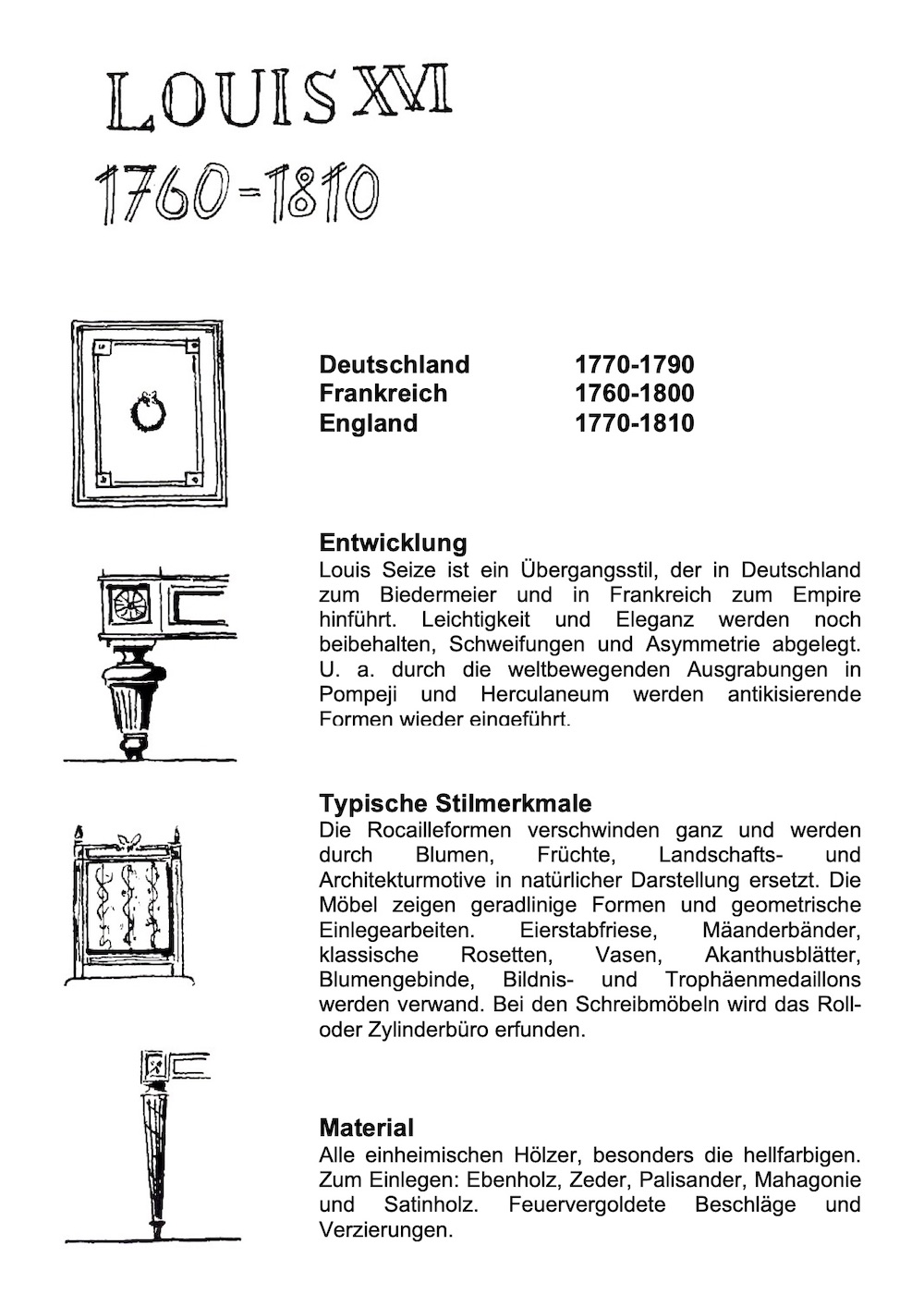
Geschichtlich und politisch ist die Regierungszeit des französischen Königs Louis XVI.
(1774 – 1792) kurz, glücklos und von höchster Brisanz. Sie mündet in die große Französische Revolution, die einen tiefen Einschnitt in die Geschichte Europas bringt. Der Durchbruch des Bürgertums bereitet sich vor, der Übergang zur modernen Welt kündigt sich an. Diese geht hervor aus der Überwindung des Barock mit seiner Strenge und Repräsentanz und des Rokoko mit seiner lustbetonten Verspieltheit, tändelnden Anmut und Diesseitigkeit. Noch besteht die monarchisch-aristokratische Gesellschaftsordnung, deren Wirtschaft auf Handwerk und Handel gegründet ist.
England erlebt als erstes Land Europas die industrielle Revolution, die zu Groindustrie und Maschinenwesen führt. Trotz des lebhaften Handels zwischen England und Deutschland fasst der industrielle Fortschritt hier viel langsamer Fuß. Daraus resultiert auch ein politisches Nachhinken Deutschlands hinter seinen Nachbarn. Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg wirft lange Schatten auf Europa. Die westliche Welt steht an einer Zeitwende: sie erlebt die Kindertage der Technisierung, die auf unvorstellbare Weise das Leben der Menschheit wandeln wird.
Die Kunst ist nicht mehr höfisch; sie geht wie Technik, Wissenschaft, Dichtung und Philosophie vom Bürgertum aus: Kant vollendet “Die Kritik der reinen Vernunft“, fast gleichzeitig komponiert Mozart “Figaros Hochzeit“ und “Don Giovanni“, Goethe schreibt “Iphigenie“, Schillers erste Veröffentlichungen erscheinen, Langhans vollendet das Brandenburger Tor, Galvani entdeckt die galvanischen Ströme, Cartwright entwickelt den mechanischen Webstuhl, die erste Montgolfiere steigt auf.
Die von Stürmen und Unruhen durchtobte Zeit des ausgehenden 18. Jahrhunderts verschreibt sich dem kühlen, in sich ruhenden Stil des Klassizismus; die Epoche des Umbruchs und des Widerspruchs soll gebändigt werden in der ewig gültigen Schönheit griechischer Formen. So trägt auch in Frankreich die erste Epoche des Klassizismus den Namen Louis Seize, obwohl dieser Stil in Frankreich ganz eindeutig bereits ab 1750 vorzufinden ist. Er existiert nachweislich parallel zum Rokoko. Ebenso irreführend ist der deutsche Ausdruck Zopfstil. Ganz gewiss hat er nichts mit der damals modernen Zopfhaartracht für Herren zu tun. “Zopfig“ bedeutet im Sprachgebrauch des 18.Jh. veraltet, geschmacklos, unmodern. Damit hat man speziell alle Barock- und auch Rokokoschöpfungen gemeint.
Der Anstoß zum neuen Stil geht von Frankreich aus, ist jedoch in der englischen Architektur zu diesem Zeitpunkt schon fast verankert. Zunächst ist das Louis Seize eine Periode unsicheren Tastens, Rokoko-Elemente werden mit den neuen antikisierenden Motiven vermengt auf der Suche nach einem Vorbild wahrer Schönheit. Frankreich und England nehmen gleichermaßen Einfluß auf die Verbreitung der neuen Strömung: Frankreich durch seine politischen Ideen, England durch seinen exzellent organisierten Handel. Der Engländer John Flaxmann z.B. sorgt mit seinen graphischen und kunstgewerblichen Darstellungen für eine weite Verbreitung der klassizistischen Tendenzen; Josiah Wedgewood benutzt dessen Vorlagen für seine Terrakotta- Produkte – er treibt lebhaften Handel bis tief ins kontinentale Festland hinein. Ein großer Teil seiner bürgerlichen Kundschaft lebt im deutschsprachigen Raum. Eine Vereinheitlichung der Stilmerkmale wird durch die Verbreitung von Reihenwerken der Vorlagenstecher und von Zeitschriften erreicht. Ihre erstaunlich hohen Auflagen verbreiten Kenntnis von stilistisch signifikanten Einzelheiten erstmals im Kreis Laien (bürgerliche Auftraggeber).
Die Möbel sind dekoriert mit Pilastern, Gehängen, Schlusssteinen, Perlstäben und Vasen. Die Linien des Rokoko werden gerade, die geschweiften Beine, Zargen und Fronten strecken sich, Muschelmotive und Rankenwerk verschwinden. Ab 1780 werden die Einrichtungsgegenstände leichter und zierlicher, knapp und klar im Umriss, sparsam im Dekor, ihre Stärke liegt in Formenreichtum und Eleganz. Der Reiz der Oberfläche wird durch ausgesuchte Hölzer erreicht: neben dem heimischen Nussbaum und Ahorn erfreuen sich Rosenholz und Mahagoni großer Beliebtheit. Die Schellack-Politur mit ihren exquisiten Lichteffekten kommt auf. Symmetrisches Rahmenwerk der Möbel ist verbunden mit stilisierten Arabesken, zwischen schmalen, zarten Säulen liegen hochrechteckige Felder mit Eckrosetten. Der Kunsthandwerker schnitzt zwischen die Kapitelle der Pilaster zierliche Friese aus Kränzen oder Kranzgehängen. Umlaufende Querfurniere oder einfache, aufgesetzte Leisten bestimmen die Front der Möbelstücke; Bandschleifen, Füllhorn, Lyra, Vasen, sich schnäbelnde Tauben sind gefragte Motive für Schnitzereien oder Einlegearbeiten. Auch Blumeneinlagen dürfen die Oberfläche schmücken. Beine und Korpus sind gerade und schlank, auf den Schränken laufen aus England entlehnte zierlichst durchbrochene Galerien. Als Ornament besonders beliebt sind aus Bronze gefertigte Perlschnüre; überhaupt werden bei den meisterlichen Schreinerarbeiten gern Metallapplikationen gesehen, jedoch ist der Gesamteindruck stets zurückhaltend. Es entstehen heute noch sehr gesuchte Meisterstücke von virtuoser Technik. Der wohl bekannteste Schreiner dieser perfekten Kunstwerke ist David Roentgen.
Grazie und Zurückhaltung der Möbelform verlangen nach feinen, hellen, zarten Farben, die Anmut vermitteln. Die Stoffe sind äußerst fein gewebt, durchwirkt mit farblich abgesetzten Blumenkränzen und Bouquets. Das Louis Seize kreiert auch die farbige Papiertapete. Durch vertikal gestreifte Muster wirken die Räume höher und luftiger; das lichte Ambiente wird unterstrichen durch Plafond-Gesimse und Türeinfassungen, deren Profile mit gewundenen Bändern geziert sind. Für diese ästhetisch ansprechende Umgebung muß sich auch die Mode ändern : die bezopfte Männerhaartracht weicht dem Tituskopf, die Herrenmode wird sachlicher. Man trägt Frackrock und Halstuch. Bei den Damen verschwinden die gepuderten Perücken und der Reifrock. Fedrige, auf dem Kopf getürmte Löckchen werden à la grecque von Seidenbändern gehalten, tiefdekolletierte Kleider mit Puffärmelchen aus fließenden, dünnen Stoffen umspielen die Gestalt, zunächst trägt man noch ein Brusttuch, das jedoch später weggelassen wird. In der Zeit des Louis XVI ist das Kunsthandwerk auf allen Gebieten ungemein fein entwickelt: Marketterie, Schnitzerei, wundervolle Bronzen, Pastellbilder, kolorierte Kupferstiche, zartes Porzellan und Nippes, edle Silber- und Goldschmiedearbeiten von unerreichter Schlichtheit und Eleganz. Der Charme all dieser Gegenstände bezaubert heute noch mit seiner unaufdringlichen Grazie, aber auch mit handwerklicher Perfektion.
KLASSIZISMUS
Der Begriff Klassizismus umfasst die Zeit von 1790 bis 1845 und die Epochen Louis Seize, Empire, Biedermeier und Regency (letzteres wird unter dem Stichwort Englische Möbel behandelt).
Klassizismus bezeichnet eine sich an die Vollendung der Klassik anlehnende Epoche. In dem reichen und bis dahin letztendlich auch einheitlichen Garten europäischer Stile taucht immer wieder die alte und ewig junge Sehnsucht nach der Antike auf. Die Strömung des Klassizismus erhält aus verschiedenen Quellen kräftige Antriebe: In Deutschland beeinflussen Lessing und Klopstock die Philosophie der Aufklärung nachhaltig und geben ihr eine antikisierende Richtung. Sie beinhaltet eine radikale Absage an Feudalismus und Absolutismus. Gleichzeitig finden die revolutionierenden Gedanken Rousseaus eine breite Anhängerschaft in ganz Europa.
Für die Verfechter des Klassizismus gilt die Antike als veredelte Natur, Natur wird als Ausdruck der Wahrheit verehrt. Im Jahr 1738 wird Herculaneum ausgegraben, 1748 beginnen die vielbeachteten Ausgrabungen von Pompeji, die 1763 beendet werden. J.J. Winckelmann veröffentlicht 1755 seine weltbekannte Schrift "Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst“, 1761 erscheint das epochale Werk der englischen Brüder Adams “Antiquities of Athens“. Systematische Darstellungen von Forschungsergebnissen werden herausgegeben, darauf folgen kunsttheoretische und philosophische Schriften. In all diesen Werken liegen die Wurzeln des Klassizismus, des ersten Stils, der von kunstwissenschaftlichen Erkenntnissen ausgeht, also intellektuelle Wurzeln hat. Es entwickelt sich eine Art Ideologie, eine rigide Reaktion auf die vielfältige und manchmal absurde Formensprache des Rokoko.
Vorbilder aus der Antike in ihrer Reinheit werden bewusst nachgeahmt. Das Bestreben des Klassizismus ist es, allgemeingültige Muster aufzustellen, ewigen Gesetzen Ausdruck zu geben, rationalistisch die Welt zu bändigen, den Menschen zum Maß aller Dinge zu machen. In den Normen der Antike glaubt er, die Harmonie des Kosmos gespiegelt zu sehen. Radikale Ideen französischer Architekten fordern die Rückführung von Bauformen auf archaische Strukturen, allen voran die dorische Ordnung. Man sieht Maß und Ordnung, stellt sich edle Einfalt und stille Größe vor.
KLASSIZISMUS EMPIRE
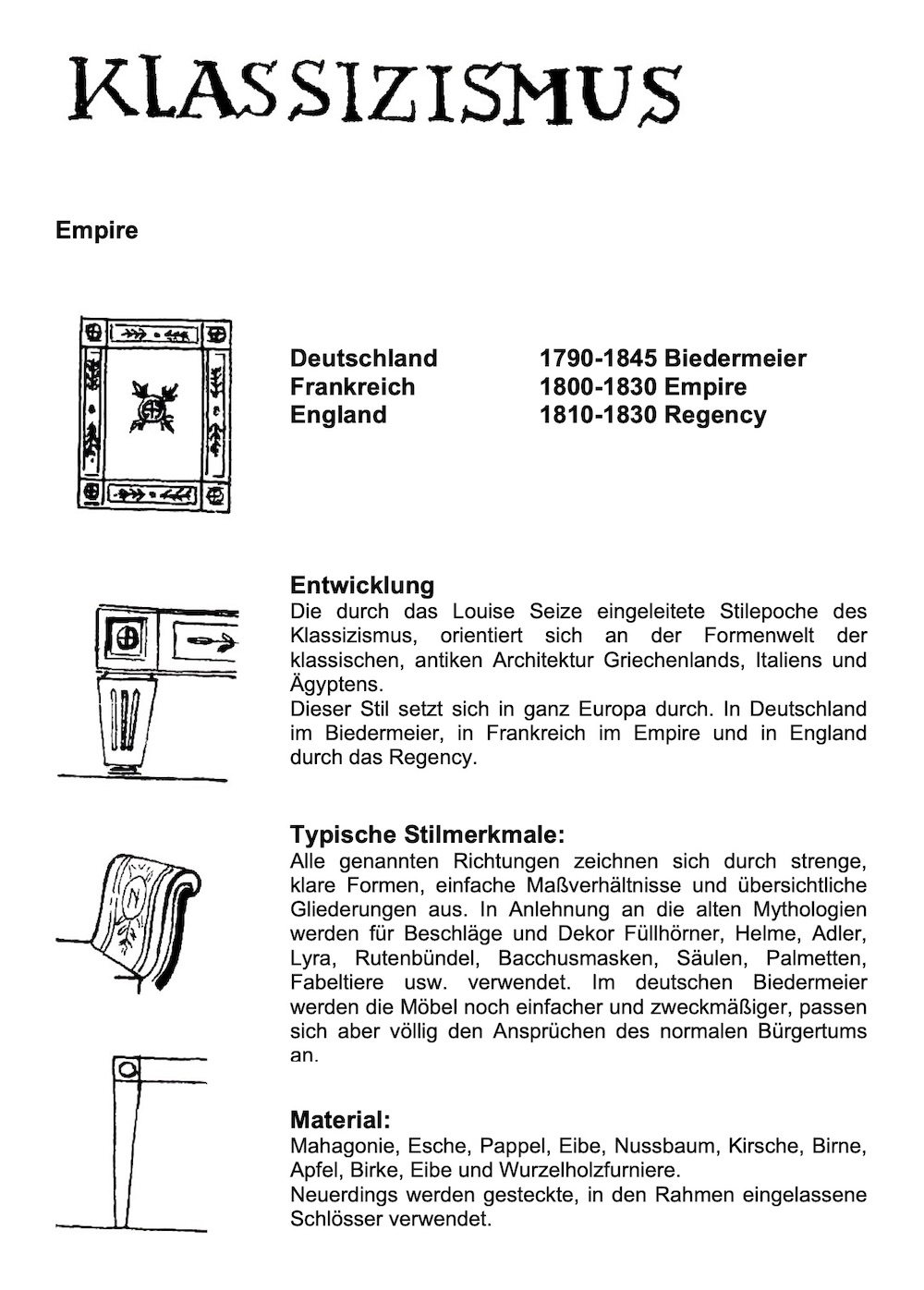
Empire
14.Juli 1789 – Sturm auf die Bastille.
Die neuerliche Erhöhung der Brotpreise setzt ein ausgebeutetes Volk in Gang. Der glücklose Hobbyschreiner Louis XVI. und seine Gattin Marie Antoinette verstehen die Welt nicht mehr. Die törichte Königin lässt den Anführern des auf Versailles marschierenden Pöbels ausrichten, sie mögen doch Kuchen essen, wenn sie kein Brot haben! Drei Jahre noch darf das Königspaar dem chaotischen Treiben der Jakobiner machtlos zuschauen, dann wird ihrer beider Leben gewaltsam beendet. Ihnen folgen zahllose Angehörige des Adels auf dem Weg zur Guillotine, sofern sie sich nicht beizeiten ins Ausland flüchten können. Eine Flut überschwemmt Europa, die deutschen Fürsten werden aus ihrem Dornröschenschlaf gerissen. Mit den ersten Wellen schwappen Ideen über die Alpen, die Maas, den Rhein.
Dann kommt ein junger General, Napoleon, mittlerweile erster Konsul der französischen Republik. Mit seinen zahlreichen Kriegszügen macht er sich selbst quasi zum Zwangsvollstrecker der Ideen der Französischen Revolution und der von ihm initiierten, umwälzenden Neuerungen. An Napoleons Seite findet sich eine raffinierte, erfahrene Frau von zweifelhaftem Ruf, Joséphine. Diese Ehe macht auch dem Papst schwer zu schaffen, als dieser von Napoleon gezwungen wird, nach Paris zu reisen und den “Ersten Konsul auf Lebenszeit“ zwischen zwei Kriegen geschwind zum Kaiser zu krönen. Der korsische Emporkömmling setzt sich selbst ein Denkmal und die Krone auf. Das Glück scheint den jungen Mann nicht zu verlassen; zahllos sind die Versuche europäischer Monarchen von der Moskwa bis zur Themse, Napoleon aufzuhalten. Er ist buchstäblich nicht zu bremsen. Der junge Bürgerkaiser überzieht Europa mit einer Flut von neuen Gesetzen und Verwaltungen. Was wäre die Rechtsprechung in Deutschland z.B. ohne den Code Napoleon! Um den Fortbestand der Dynastie Bonaparte zu sichern, verlässt Napoleon die unfruchtbare Joséphine und heiratet Marie Louise von Österreich, die ihm pflichtschuldigst einen Sohn schenkt. Als sich der Kaiser auf der Höhe seines Rums wähnt, lässt sich sein Untergang schon ahnen. Die europäischen Fürsten haben ihre Lektion gelernt, Napoleon verliert wichtige Schlachten. Kurzfristig muß er unter dem Zwang der Aliierten seinen Wohnsitz auf Elba nehmen. Dort hält es ihn nicht lange, er kehrt zurück. Schnurstracks versammelt er die Reste der “grande armée“ um sich und marschiert nach Waterloo. Die Folge ist sein Exil auf St. Helena, wo er 1821 stirbt. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Französische Revolution und ihre Folgen die gesamte westliche Kultur beeinflusst haben. Ohne sie ist unsere modernen Welt nur schwer vorstellbar.
Das Empire ist der persönliche Repräsentationsstil Napoleons, ein Rückgriff auf den Stil der französischen Kaiserzeit. Napoleon selbst regt die neue Mode an. Die europäischen Fürsten nehmen den neuen, höfischen Pomp begeistert auf: endlich wieder eine Einrichtung, durch die man sich vom ständig selbstbewusster werdenden Bürgertum unterscheiden kann! Dabei spült die französische Revolution gerade dieses Bürgertum nach oben und an die Macht.
Möbel werden architektonisch konstruiert, entstehen aus dem Zusammenbau geometrischer Formen. Einige wirken fast wie eine Aufeinanderschichtung von Blöcken; Schweifungen werden zu geometrischen Biegungen. Die graziösen, ästhetisch und handwerklich perfekten Möbel des Louis XVI. müssen den schweren, gewichtigen Formen der siebziger Jahre weichen. Empire: das bedeutet Größe und Macht. Möbel müssen einem neuen Anspruch dienen, sie werden ins Imperiale erhoben. Zierliche Kühle und anmutige Sachlichkeit werden zugedeckt mit überschwänglichem Pathos. Mahagoni und Goldbronze sind die Lieblingsmaterialien, sie sollen das Möbelstück zum Monument erheben. Durch die verschwenderische Anwendung von Gold und Messing verwandelt sich manch ein Gegenstand in ein “Riesenjuwel“. Die ehemals grazilen Silhouetten verkrusten sich wuchtig mit Gold, harmonische Paneele füllen sich mit Rankenwerk aus Lotuspalmetten. Lorbeertapeten bedecken die zarte Tünche, kaiserlicher Purpur verdrängt Pastelltöne. Die Säulen werden korinthisch. Auf der extrem breiten Zarge ruht eine auffallend leichte Platte aus Holz oder Marmor, die Pilaster sind schwer, die auch gern als Lorbeerkränze tragende Karyatiden ausgebildet sind. Manches Möbelstück steht mit schwerem Sockel direkt auf dem Boden, wie z.B. das Sofa, dessen zur Seite schwingende, aber auch geraden Lehnen geschlossen sind. Dadurch wirken die Möbel wie in Stein gehauen. Wenn ein Möbelstück Füße hat, so sind es jetzt bevorzugt naturalistisch gearbeitete Löwentatzen. Armlehnstühle erscheinen thronartig, die offenen Lehnen stützen geflügelte Fabelwesen mit Löwenhäuptern aus Goldbronze. Ganzfigurige Ägypter oder Sphinxe tragen Tischplatten. Überhaupt spielt die Glorifizierung von Napoleons ruinösem Ägyptenfeldzug in der Ornamentierung der Goldbronze eine wichtige Rolle. Ägyptisch-exotische Stilmerkmale vermengen sich mit römischen Emblemen wie Harnische, Helme, gekreuzte Fahnen u.ä. Dadurch entstehen manchmal recht merkwürdige Kompositionen. Auch Joséphines Lieblingsvogel, der Schwan, muß sich die Umsetzung ins Dekorative gefallen lassen, sein geschwungener Hals dient gern zur Vorlage bei der Fertigung von Armlehnen. Der Adler, Emblem kaiserlicher Macht und römisches Feldzeichen zugleich, darf nirgendwo fehlen.
Auch das Bett ist jetzt ein kastenförmiges Möbel mit gerade hochgezogenem Kopf- und Fußteil. Seine hohen Wangen sind an der Oberseite ellipsoid ausgeschnitten oder gehen in einem eleganten, gleichmäßigen Schwung in Kopf- und Fußende über. Daraus entwickelt sich das Tagesbett, die Recamière, ein hochelegantes Möbelstück fast ohne Wangen, alle Teile in einem durchgehenden Schwung gearbeitet. Eine weitere Neuentwicklung ist der römische Scherenstuhl mit Klauenfüßen sowie der Toilette- und Rasierschrank für den Herrn. Während die Empire-Möbel französischer Provenienz durch ihren Reichtum beeindrucken, sind die in Deutschland geschreinerten Möbel zurückhaltender, leichter in der Ausstrahlung. Daher erklärt sich ihre bis heute anhaltende Attraktivität als repräsentativer Einrichtungsgegenstand.
KLASSIZISMUS BIEDERMEIER
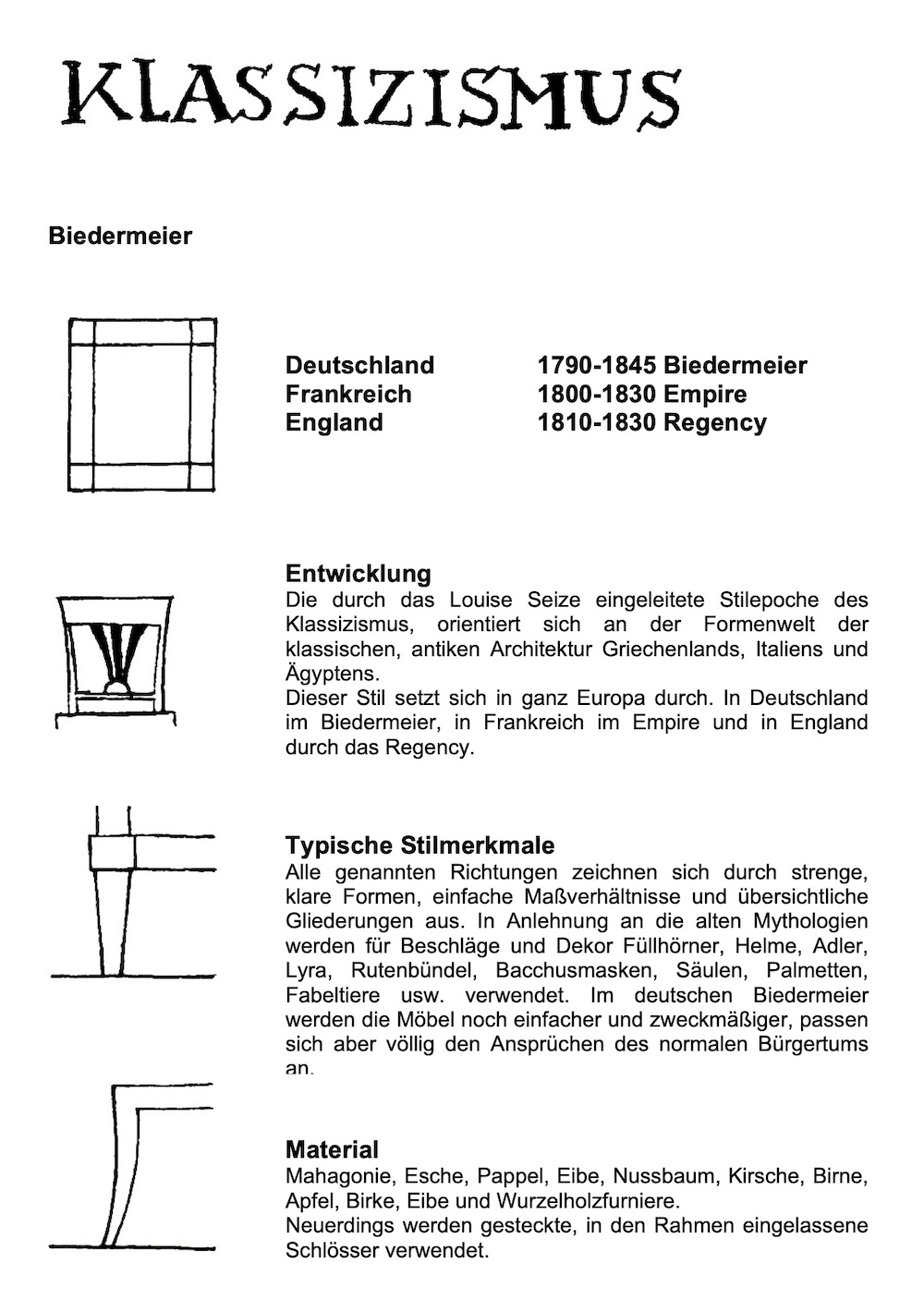
Biedermeier
Kunsthistorisch streng gefasst
1815 – 1830
Kulturhistorisch, soziologisch, politologisch
1815 – 1848
Der Heidelberger Arzt Prof. A. Kussmaul stieß 1853 als junger Landarzt auf ein Büchlein mit dem Titel “Die sämtlichen Gedichte des alten Dorfschulmeisters Friedr. Sauter, welcher“ usw., verlegt 1845 in Karlsruhe. Diese schwerfälligen Gedichte, im Stil des besser bekannten “schlesischen Schwan“ der Friederike Kempner, erschienen 1855-1857, zum Teil parodistisch überzeichnet, in den noch jungen “Fliegenden Blättern“. Das Pseudonym Gottlieb Biedermeier entsprungen einer Idee Viktor Scheffels, findet sich erstmals gedruckt 1853. Lange Zeit dachte man sich bei dem Wort Biedermeier: Engstirnigkeit, Rückschritt, Rückzug ins Private, Recht und Ordnung. Anfang dieses Jahrhunderts entwickelte sich bei seiner Wiederentdeckung erstmals eine positive Konnotation des Wortes “Biedermeier“. Sehr verständlich bei dem Bedürfnis nach Ruhe und Zurückgezogenheit nach den Wirren des ersten Weltkrieges.
Neben der allgemeinen geistigen Situation der damaligen Zeit beschäftigt uns hier in erster Linie das Biedermeier als Stilepoche der Möbelbaukunst. Das Biedermeier gilt heute als längst vergessene Wiege und Grundlage für den Funktionalismus des 20.Jahrhunderts bis hin zu den heutigen Prämierungen guter Industrieform.
Der bekannte Kunstkritiker Ludwig Hewesi stellte 1901 die Grundsätze des Biedermeier fest: zweckecht – stoffecht – zeitecht und dazu das denkbar tüchtigste Handwerk. Gleichzeitig ist nach seiner Meinung das Biedermeier Vertreter stilunabhängiger Qualität. Allgemein beurteilte man um die Jahrhundertwende den Möbelstil des Biedermeier als einen wenig repräsentativen, schlichten Kanzleistil. Dafür galt vor allem das durch eine Ausstellung bekanntgewordene Arbeitszimmer Kaiser Franz I. als Beleg, das nach Meinung eines Berichterstatters gleichsam “die Stube des ersten Bürgers eines Reiches“ verkörperte.
Von den Kunsthistorikern wird nach heutigem Verständnis das Biedermeier als die letzte Phase des Klassizismus betrachtet. Der Klassizismus steht europaweit als Sammelbegriff für die Epoche von 1770 – 1830, unterteilt in die Perioden Louis XVI., Empire und Biedermeier. Als Reaktion auf Barock und Rokoko hin zu Gradlinigkeit, Privatheit und größerer Einfachheit entstand in Frankreich das Louis XVI., in Deutschland der Zopfstil.
Durch die traditionell guten Beziehungen zwischen England und den Hansestädten existierte im Norden Deutschlands ein starker, englischer Einfluß. In England gab es allerdings bereits seit dem späten 17.Jh. eine stark klassifizierende Strömung (Hauptvertreter: Architekt Andrea Palladios). Die bekanntesten englischen Möbeldesigner des mittleren 18. Jahrhunderts, deren Einfluß Norddeutschland erreichte, waren Robert und James Adam. Zur gleichen Zeit arbeitete in Deutschland der berühmte David Roentgen, der in Frankreich seine Eindrücke sammelte. Dort forderten Mitte des 18.Jh. die französischen Enzyklopädisten konstruktive Klarheit; sie fand ihre Entsprechung in der Wiederentdeckung der Antike.
Bedingt durch politische und verwandtschaftliche Verflechtungen wurde das Wien des späten 18.Jh. zum Schmelztiegel für diese beiden starken kulturhistorischen Strömungen. Die Abneigung Österreichs gegen den überladenen, italienischen und französischen Barockstil, die frühe Hinwendung des Herrscherhauses zu mehr Leichtigkeit und Gemütlichkeit, ermöglichte dem Biedermeier in Österreich eine besonders intensive Vorbereitungszeit. Es gab einen beinah nahtlosen Übergang vom Zopfstil zum Biedermeier. Durch die politische Vorherrschaft Frankreichs auf dem ganzen Kontinent trat eine Verlangsamung des stilistischen Entwicklungsprozesses ein. Nach dem Sturz Napoleons konnte die ursprünglich konzipierte Schlichtheit problemlos wiederaufgegriffen werden. Erwähnenswert ist noch, dass Michael Thonet, Stammvater des heute weltberühmten Thonet-Stuhles, nur 50 (!!) Jahre nach David Roentgen geboren wurde. Mitten im Biedermeier gründete er seinen Geschäftsbetrieb als Bau- und Möbeltischler am Mittelrhein. Übrigens waren Thonet und Roentgen Landsleute.
Die Zeit des Biedermeier wird noch heute gern gleichgesetzt mit Beschaulichkeit, Gemütlichkeit, Solidität, Nostalgie und Ruhe. Daher ist es besonders bemerkenswert, dass sich in dieser “politisch stummen Zeit“ die, neben der französischen Revolution, bedeutendste europäische Revolution von 1848 vorbereitete. Sie führte zum Zusammenbruch des Metternichschen Systems, zur Entstehung des mitteleuropäischen Nationalstaates. Nicht umsonst heißt die Zeit vom Wiener Kongress bis zur 48er Revolution bei den Politologen “Vormärz“. Ausgehend von England über Frankreich hielt die Satire ihren Einzug in Mitteleuropa. Ebenfalls von England breiteten sich die Möglichkeiten maschineller Großproduktion in Deutschland und Österreich aus.
Das Biedermeier – eine unbedeutende, kurze Epoche unserer Geschichte – hat also fast allen Gebieten unseres heutigen Lebens seinen Stempel aufgedrückt. Und im Rückblick zeigt sich, dass diese Zeit nicht unbedingt totenstill gewesen ist. Unter der Decke jahrhundertealter “Hofgeschichtsschreibung“, die sich das Schielen nach Fürstenthronen so schnell nicht abgewöhnen möchte, gärte es gewaltig. Während Metternich das Fürsteneuropa restaurierte und dabei die historischen Schlagzeilen beherrschte, breitete sich “Bürgerlichkeit“ in alle Winkel aus und bereitete sich auf die Eroberung einer neuen Welt vor. Emsig, bescheiden, fleißig bearbeiteten die “Biedermeier“ den Boden für Kommendes: die industrielle Revolution, die soziale Revolution, die Geschmacksrevolution. So verträumten die Fürsten den Wandel von agrarischem Herrenleben zu industriellem Reichtum auf herrlichen Bällen in prunkvollen Schlössern. Und der Bourgeois hütete sich, nicht obrigkeitshörig und beflissen zu scheinen, während seine Fabriken aufblühten und deren Produkte die Welt umkrempelten. Der “Bourgeois“ muckte nicht, blieb braver Philister – ein zeittypisches Schimpfwort, das etwa dem heutigen “Spießbürger“ entspricht. Anders sein unbotmäßiger Schatten, der “Citoyen“, der nicht vergessen mochte, dass seit der französischen Revolution auch Fürstenhäupter nicht fester am Körper sitzen als die gewöhnlicher Sterblicher.
Die “Citoyen“ schnupperte die neue Zeit. Sie gedanklich auszufüllen, fühlte er sich berufen. Fichte, Schelling, Hegel – große Geister! Schopenhauers Werk “Die Welt als Wille und Vorstellung“ (1819) – der Titel ein Programm. Vorzeichen des Aufruhrs und Aufbruchs. Zur Romantik, die blaue Blume suchend, die einen: v. Eichendorff, v. Brentano, E.T.A. Hoffmann, Schlegel, Tieck usw., usf.... zur Politik, Neues denkend und erprobend, die anderen: “Turnvater“ Jahn begründete die große allgemeine Sportbewegung, Erzieher Fröbel führt 1822 in Berlin die Realschule ein. 1818 werden F.W. Raiffeisen und Karl Marx geboren; ihrer beider “Genossenschaften“ werden die Welt verändern. Georg Büchner brennt vor Ungeduld, sein hessischer Landesherr brennt darauf, ihn unschädlich zu machen.
Die Unruhe der “Citoyens“ – eingeklemmt zwischen Fürsten einerseits, “Bourgeois“ andererseits und den Blick auf ein sich schüchtern zu Wort meldendes Proletariat gerichtet – die Unruhe der “Citoyens“ macht sich Luft: In aufrührerischen Schriften vom “Hessischen Landesboten“ (G. Büchner) bis zum “Kommunistischen Manifest“ (K. Marx), in der “Rheinischen Zeitung“ (H. Heine), im “Deutschen Charivari“, in den “Fliegenden Blättern“. Mit Bissigkeit, Witz und Spott legt die geistige “Creme“ der Zeit schonungslos deren Schwächen bloß. Eine langweilige Zeit? Es war, als wollte die Geschichte Atem holen, der neuen Klasse der Bürger Zeit geben, die Zukunft zu planen.
Wir sind heute diese Zukunft. Im Guten wie im Bösen. Und wenn wir uns in modischen Wellen nach dieser “beschaulichen Zeit“ und ihren klar gezeichneten, schnörkellosen Linien sehnen, könnte es sein, dass wir wieder eine Zeit zum Nachdenken und zum Kräftesammeln brauchen? Und wir sitzen heute wie damals – vom Revoluzzer bis zum Unternehmer – in Möbeln und Kunstgegenständen von bisher unerreichter Schlichtheit.
KLASSIZISMUS REGENCY
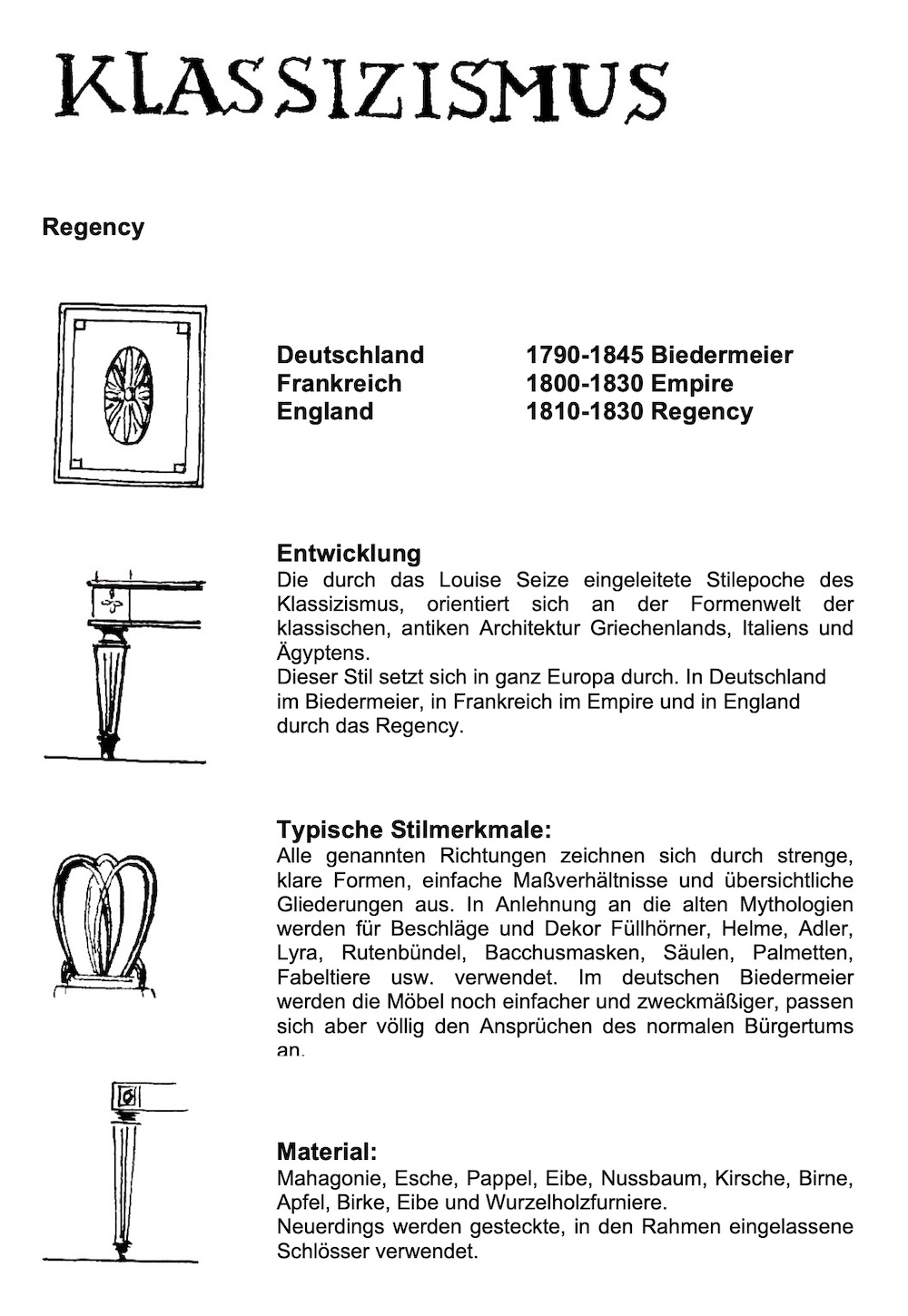
HISTORISMUS
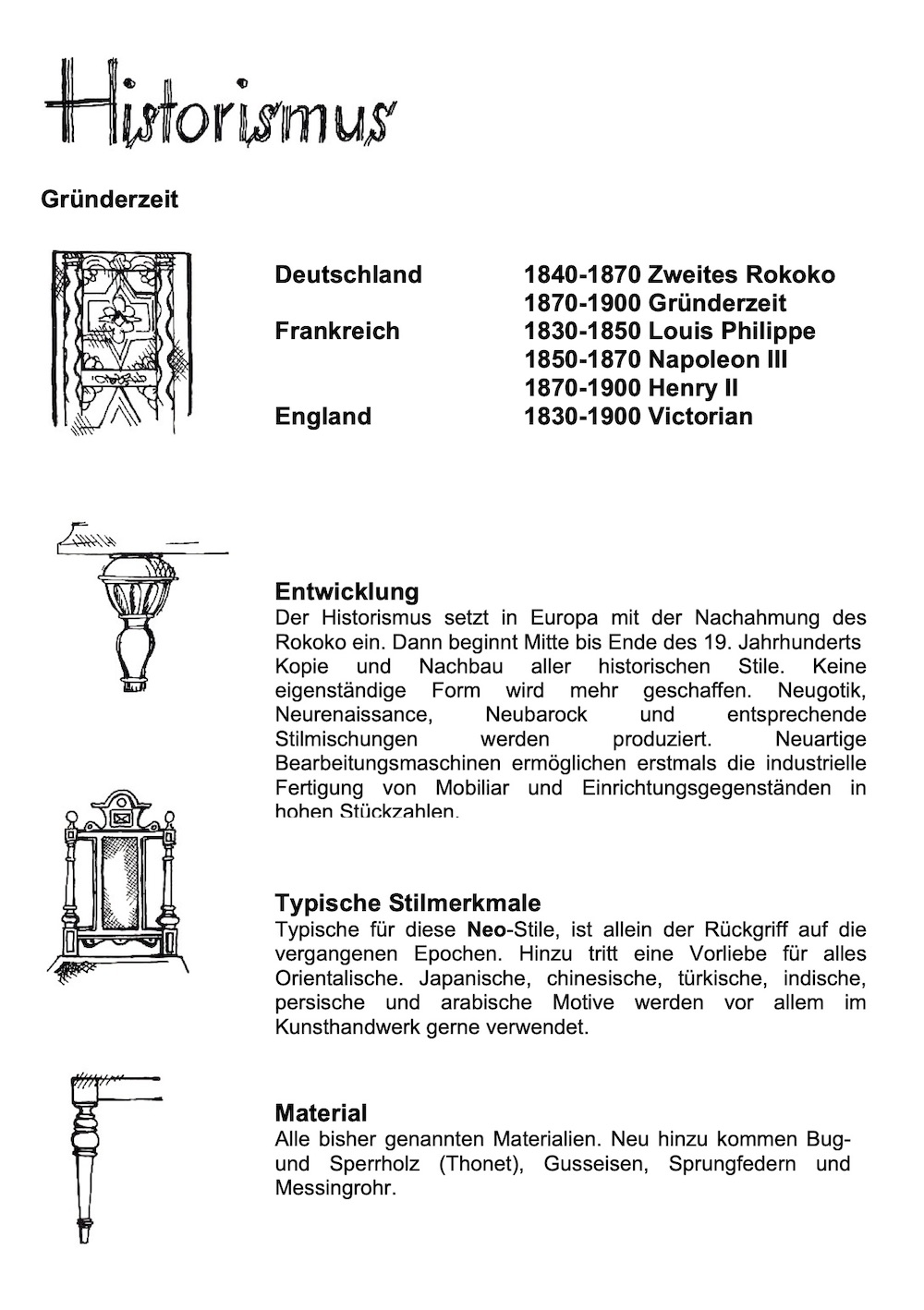
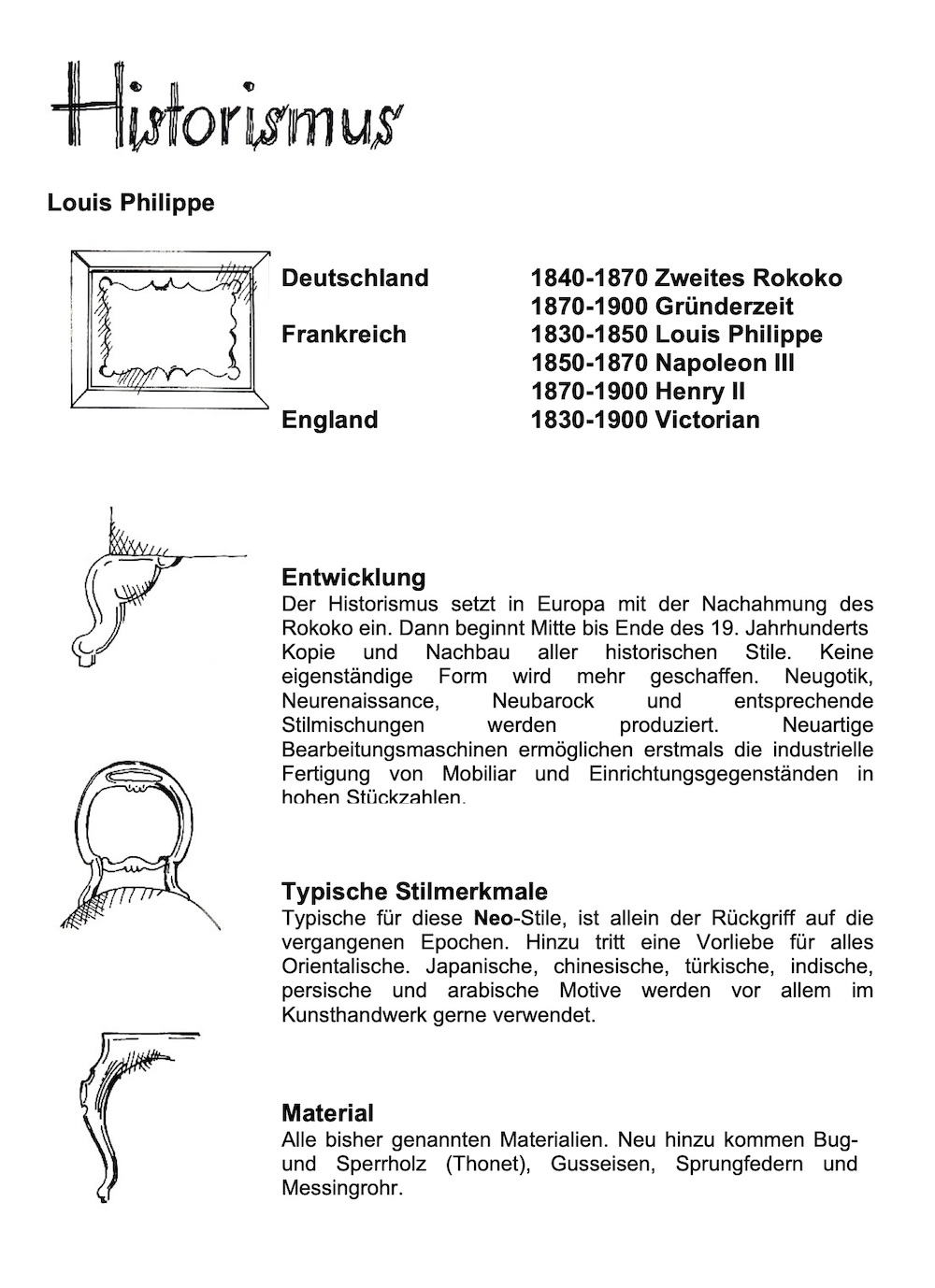
Aus dem Bereich der Natur- und damals noch jungen Gesellschaftswissenschaften stammt der Begriff Historismus. Wie alle wichtigen kunst- und kulturhistorischen Epochen bereitete sich der Historismus lange vor seinem manifesten Erscheinen vor. Als seine eigentliche Wiege kann man wohl den Geist der Romantik bezeichnen. Doch auch diese lässt sich ohne Vorgeschichte kaum erklären. Allgemein wird der Klassizismus mit seinem Postulat der in den Regeln gefassten Übereinstimmung von Vernunft und Natur als letzter einheitlicher europäischer Stil betrachtet. Er griff mit seinen antikisierenden Tendenzen auf alle Lebensbereiche über.
Als Reaktion auf die “clarté“ entwickelte sich daraus Ende des 18. Jahrhunderts die Romantik. Für ein besseres Verständnis des folgenden Historismus einige Stichworte zur Romantik zuvor: Suche nach neuen Ausdrucksformen, “altdeutsche Kunst“, unter der hauptsächlich die historische Gotik verstanden wurde, “Ritterburgen“, beeindruckendes Geschichtswissen, Vaterlandsliebe. Obwohl sich die Romantik nur in Dichtkunst, Malerei und Musik niederschlug, d.h. nie eine große Bewegung war, kommen ihr erhebliche Verdienste um die Zukunft zu. Ohne die sorgfältige Beschäftigung des Romantikers mit der mittelalterlichen Geschichte ist der Historismus schwer vorstellbar. Denn daraus entstanden im19. Jahrhundert starke Einflüsse auf Geistes- und Naturwissenschaften, Architektur und Möbelbaukunst. Der Historismus wird daher in der kunsthistorischen Literatur auch als “Rückgriffskunst“ oder “Rückblickzeit“ bezeichnet. W. Götz schreibt: “Die Auswahl der historischen Formen erfolgt nicht primär wegen ihrer ästhetischen Affinität, sondern wegen ihrer geschichtlichen Relevanz.“
Die Auflockerung der Biedermeiermöbel mit neogotischen Applikationen oder sacht geschweiften Giebeln um 1835-40, das Auftauchen des zweiten Rokoko in Frankreich signalisieren den Beginn des Historismus. Seinen ersten großen offiziellen Auftritt hat er bei der ersten Weltausstellung in London 1851. Über 6 Millionen Besucher werden im “Kristallpalast“ Zeugen des für den Historismus typischen Stilpluralismus: Neo-Gotik, zweites Rokoko, Neo-Renaissance, Neo-Barock und drittes Rokoko.
Neo-Gotik
Die “Neo-Gotik“ hat, wie schon oben erwähnt, ihre Wurzeln in der Romantik. Friedrich-Wilhelm IV. von Preußen betreibt aufgrund von Einflüssen dieser Zeit die endliche Fertigstellung des Kölner Doms (feierliche Einweihung 1880). Wir erwähnen gerade dieses Beispiel, um aufzuzeigen, dass die Neo-Gotik nicht ein bloßes Applizieren neogotischer Elemente auf vorgegebene Biedermeiermöbel war, sondern dass alte Konstruktionsanleitungen und Bauweisen sorgfältig beachtet wurden. Schließlich lagen von Architekten und Handwerkern viel beachtete genaue Werkunterlagen der originalen Gotik vor.
Damit werden die Grundformen des Biedermeier abgelöst. Aus den ersten neogotischen Gehversuchen der Romantik entsteht durch zahlreiche Veröffentlichungen in den vierziger Jahren der dogmatische Historismus. Bei der Architektur von Monumental-Bauten wie Schlössern und Domen ist die Neo-Gotik ab Mitte des 19.Jh. der bevorzugte Baustil. Später greift er auf Profan-Bauten über wie Rathäuser oder repräsentative Wohnhäuser. Bei den folgenden Weltausstellungen lassen die neogotischen Strömungen nach, ohne jedoch ganz zu verschwinden. Übrigens hat in den ersten fünfzig Jahren des vergangenen Jahrhunderts auch der Antiquitätenhandel seinen Anfang genommen.
Zweites Rokoko
In Frankreich entwickelte sich derweil durch die Vorliebe des Königs X. eine Bevorzugung des “Rokoko“. Der seit 1824 regierende König gab sich ausgesprochen bürgerlich. Mit seiner “Volksnähe“ sorgte er für eine rasche Verbreitung des “Neo-Rokoko“ und machte somit der französischen “clarté“ den Garaus. Fälschlicherweise wurde der französische König Louis-Philippe (1830-48), “König Birne“) zum Namensgeber für diesen Stil.
Die Entwicklung des Neo-Rokoko kann als das wieder zunehmende Bedürfnis nach Ornamentik und Bewegung gedeutet werden, als Reaktion auf das strenge, schmucklose, geometrische Biedermeier. Zögernde Schweifung von Giebelbrettern, gedrechselte Säulen, Flammleisten, abgerundete Ecken an Sims und Sockel signalisieren die Ablösung des Biedermeier. Die Möbel bleiben aber immer noch streng geometrisch, so werden diese frühen Louis-Philippe-Möbel noch häufig irrigerweise als “Spät-Biedermeier“ verkauft.
Im deutschsprachigen Raum rezipierte man diese Strömung nur langsam. In Österreich herrschte Fürst von Metternich (Importeur von Michael Thonet). Er bereitete mit seiner restaurativen, zum Absolutismus tendierenden Politik den Boden für den Wiedereinzug des Geschmacks des 18.Jh. Rasch wurde Wien dominierend in Architektur und Kunstgewerbe. Kaiser Franz-Josef, besser bekannt als Ehemann von “Sissy“, herrschte genauso autokratisch wie Metternich. Er war ein begeisterter Anhänger des Neo-Rokoko.
In seinen Anfängen war diese Stilrichtung im Norden Deutschlands zunächst ein reiner Ausstattungsstil. Doch da die Preußen nicht nachstehen wollten, erklärten sie das Neo-Rokoko kurzerhand zum offiziellen Hofstil. Eine konsequente Verbürgerlichung dieser Strömung findet erst danach in Österreich und Deutschland statt. Die "Garnitur“ entsteht, der Schreibtisch wird nicht mehr frei in den Raum gestellt, ein kleines Aufsatzmöbel, Vertiko genannt, wird entwickelt. Die Sofas haben runde, geschwungene Lehnen, die dreigeteilt sind, die Rundung wiederholt sich in der Stuhllehne. Mehrpassige Balusterfüße an Tischen und Kleinmöbeln werden geschreinert, die hochelegante Boulle-Technik wird wiederentdeckt; ebenso zwei Sesseltypen, die Bergère und der Voltaire.
Das Erscheinungsbild der Ausstattung gibt sich runder, geschwungener, behäbiger, Ziernägel an den Polsterlehnen halten ihren Einzug und der ochsenblutrote Seidendamast. Im bürgerlichen Preußen gibt man großblumiger Baumwolle den Vorzug. S-und C-Schwünge, geschnitzte Ranken- und Blattornamente, Kartuschen und Muscheldekor schmücken plötzlich wieder allenthalben die beliebten Ausstattungsgegenstände.
Zusammenfassend lässt sich über das Neo-Rokoko sagen, dass die Entwürfe dieser Zeit nie Kopien des historischen Rokoko waren oder sein sollten. Diese Feststellung treffen übereinstimmend alle Kenner dieser Zeit. Vielmehr entlieh man – ziemlich wahllos – aus Barock und Rokoko Stilelemente, gab aber die Symmetrie des Biedermeier nicht auf. Durch eigene Phantasien entstanden teilweise wirklich elegante, einfallsreiche Gegenstände.
Neo-Renaissance – “Gründerzeit“
Bei der Weltausstellung 1867 zeigt sich, dass die Modetrends sich unterschiedlich entwickeln. Während man in Frankreich unter Napoleon III. verstärkt zu einer Wiederentdeckung des Louis XVI. neigt, erfreut sich in Deutschland und England das Neo-Rokoko (Louis-Philippe, Victorian) weiter größter Beliebtheit. Dies ändert sich, als ab 1870 etwa die sich schon öfter und länger angekündigte und immer wieder aufgeschobene “Neo-Renaissance“ vorkämpft. Bei uns ist sie in ihrer Hoch-Zeit besser bekannt als “Gründerzeit“. Seit 1840 gab es vereinzelte Versuche, Gebrauchsgegenstände mit reinen Renaissance-Elementen der Öffentlichkeit schmackhaft zu machen. Es handelte sich um Neuschöpfungen, die sich allerdings erstaunlich exakter historischer Details bedienten. Auch hier – wie bei den beiden oben beschriebenen Richtungen – auffallend die profunden und exakten Kenntnisse originaler Renaissance-Architektur und Werkvorlagen.
Alle Strömungen des Historismus fanden durch die Architektur ihren Weg in die Möbel. Bestes Beispiel: Wien mit der Neuen Hofburg und seinen zahlreichen Museen. So werden in der Neo-Renaissance die kastenförmigen Möbel wiederentdeckt, z.B. die Kredenz – in der historischen Renaissance Dressoir genannt. Behaglich schimmernd in gebeiztem Eichenholz oder Nussbaum präsentiert sie sich mit reichem Schnitzwerk: Kartuschen, Figuren, Akanthus-Blätter schmücken ihre Oberfläche. Sie steht auf Tatzen- oder gedrückten Ballenfüßen, ihre Ecklisenen sind geschmückt mit Schuppenschnitzereien oder Pilastern, Sims und Sockel können gekröpft sein. Die Tische ruhen auf schweren Balusterfüßen, den hochlehnigen Stuhl zieren Balustergalerien, die Sitzfläche besteht aus Rohrgeflecht, geschorenem Plüsch oder gepunztem Leder.
In bester Verarbeitung und edelsten Materialien gibt es wieder Stollen- und Kabinettschränke. In Österreich geben ästhetische Impulse den Anstoß zu Neo-Renaissance, in Deutschland ist es eher das Erwachen zu nationalem Selbstbewusstsein, bedingt durch die Reichsgründung 1871. Ein zeitgenössischer Historiker beschreibt dieses Erstehen und vergleicht es mit der Zeit der Reformation. Es ist ein Wieder-Anknüpfen an eine Epoche, in der Deutsch-Sein stolz machte (Ulrich v. Hütten u.a.). Die Gründerzeit steht synonym für enormem wirtschaftlichen Aufschwung und steigendem Wohlstand des Bürgertums. Durch die jetzt ständige weitere Entwicklung und den Einsatz von Maschinen werden die Gegenstände für den Mittelstand erschwinglich. Ohne die rasante Industrialisierung Englands und Kontinentaleuropas wäre der Vormarsch des Kunstgewerbes in dieser Breite überhaupt nicht denkbar.
Dies seit Mitte des letzten Jahrhunderts überall entstehenden Handels- und Gewerbevereine und ihre Veröffentlichungen wirkten stark geschmacksbildend auf die Menschen vor hundert Jahren. Zugleich brachte verstärkte wirtschaftliche Expansion entsprechende bürgerliche Repräsentation mit sich. Die Neo-Renaissance ist wohl die bürgerlichste aller Historismus-Strömungen.
In ihrer Weiterentwicklung zeigt die Neo-Renaissance dann durch das Einbeziehen früh-barocker Stilelemente eine Tendenz zum Bewegten und Malerischen. Nur durch die genaue Kenntnis der alten Werkvorlagen konnte man es sich leisten, so unbekümmert mit historischen Stilelementen zu experimentieren. Insofern ist eine intensive Auseinandersetzung mit dem Barock und weiter mit dem Rokoko eine beinahe organische Entwicklung. Zumal die Neo-Renaissance für den Adel wenig elegant und exklusiv erschien und so durchgehend von ihm abgelehnt wurde.
Im Vergleich zum Neo-Rokoko der Jahrhundertwende sind jetzt aber die Stilkenntnisse erheblich besser und genauer. Da sind sie wieder, die C-Schwünge, Rocaillen, Schnitzereien, Gitterwerke, S-Beine. Das alles aus edelsten Hölzern; einheimische Obsthölzer von wenig exklusivem Charakter werden kurzerhand vergoldet; besonders schick sind weißgold gefasste Möbel, die mit aufwendigen Stoffen bezogen werden. Kaiser Wilhelm II. renoviert das Schloss Sanssouci und stattet es wie oben beschrieben aus. Von ihm werden für eine Weltausstellung Möbel des dritten Rokoko als für Deutschland repräsentativen Stil in Auftrag gegeben. Mit Hilfe moderner Maschinen können auch preiswerte Gebrauchsgegenstände für jedermann in dieser aufwendigen Geschmacksrichtung gefertigt werden.
Kolonialer Einfluß
Erwähnenswert ist mit diesem Wiederblühen des Kolonialismus eine wellenartige Auseinandersetzung mit den verschiedenen Erscheinungsformen kolonialer Kulturen.
Bedingt durch die massive Industrialisierung und stürmische Entwicklung des Bankwesens, sind Einflüsse der vereinnahmten Länder zu beobachten. Königin Viktoria wird Kaiserin von Indien. Während Europa in der Prüderie des viktorianischen und wilhelminischen Zeitalters erstarrt, unternehmen vereinzelte Protagonisten Ausflüge in die scheinbare Traumwelt des Orient. Verbotene Wollust vermittelnde, geistige Opiumschwaden wabern in fürstliche Gärten, Lustpavillons, Boudoirs und versinken in schwelgerischen Polstern. Man raucht sich einen Traum. Geblieben ist davon unsere Vorliebe für orientalische Teppiche.
Doch der Historismus wollte nie – mit geringen Ausnahmen – fälschen, sondern durch genaue Kenntnis der Vergangenheit zu Eigenem, Neuem gelangen. Die unterschiedlichen Erscheinungsbilder des Historismus waren keine Modewechsel, sondern der ihm typische Stilpluralismus. Allerdings gab es eine Imitation von Materialien, teilweise bei Massenproduktion auch Surrogate, wie Gusseisen, Papiermaché. Es entsteht der neue Begriff der Kunstindustrie. Trotz der Industrialisierung hatte der Historismus auch für das Handwerk Vorteile, die noch heute bei jeder Meisterprüfung zum Tragen kommen: Wiedererlangung des verloren gegangenen Wissens um traditionelle Handwerkstechniken. Denn sooft wir auch von Industrialisierung gesprochen haben, es gab verstärkt handwerkliche Luxusproduktion. Der Historismus hatte immer eine restaurative und eine suchende Komponente. Nach Kreisel und Bahns muß heute mit Entschiedenheit festgestellt werden, dass der viel verachtete Historismus erheblich mehr war als Nachahmung. Er war immer der Versuch, Neues, Eigenständiges zu schaffen auf der Grundlage profundester Geschichtskenntnisse. Und wer hätte gedacht, dass in den späten fünfziger Jahren die “altdeutschen“ Möbel und Bilder wieder Triumphe feierten, diesmal allerdings als rein bürgerliche und kleinbürgerliche Geschmacksrichtung. Mittlerweile zeigt sich im Antiquitätenhandel deutlich, dass der Kunde die Möbel dieser Zeit zu schätzen weiß. Louis-Philippe und Gründerzeitgegenstände sind gefragt, Händler beginnen, sich zu spezialisieren.
Möbelschreiner und Entwerfer Neo-Gotik:
Fa. Hoffmeister, Coburg / Herwegen, München / Fortner, München / Karl Wild, Regensburg / Grube, Lübeck
Louis und Siegfried Löwinson, Conrad Wilhelm Hase, Hannover
Neu-Rokoko (Louis-Philippe):
Johann Nepomuk Geyer, Innsbruck / Carl Leistler, Wien / Michael Thonet, Boppard-Wien / Barter, Würzburg / Neppenbacher, Würzburg / August Kitschelt, Wien /C. G. Lehmann, Berlin
Neo-Renaissance (Gründerzeit):
F. Gröger, Wien / M. Hagen, Erfurt / Löwinson, Berlin / Baube, Mainz / J. Heininger, Mainz / L. Sawatka, Wien / C. Hehl, Hannover / H. Sauermann, Flensburg
Neo-Barock, drittes Rokoko:
Julius Hoffmann, München / Stellberger, Ballin, München
Bauwerke des Historismus:
Kölner Dom (teilweise) / Semper-Oper Dresden / Palast Leuchtenberg / Anbau der Münchner Residenz / Schloss Schwerin / Kristallpalast London / Herrenchiemsee / Linderhof / Schloss Sigmaringen / Schloss Neuschwanstein / Neue Wiener Hofburg .
JUGENDSTIL
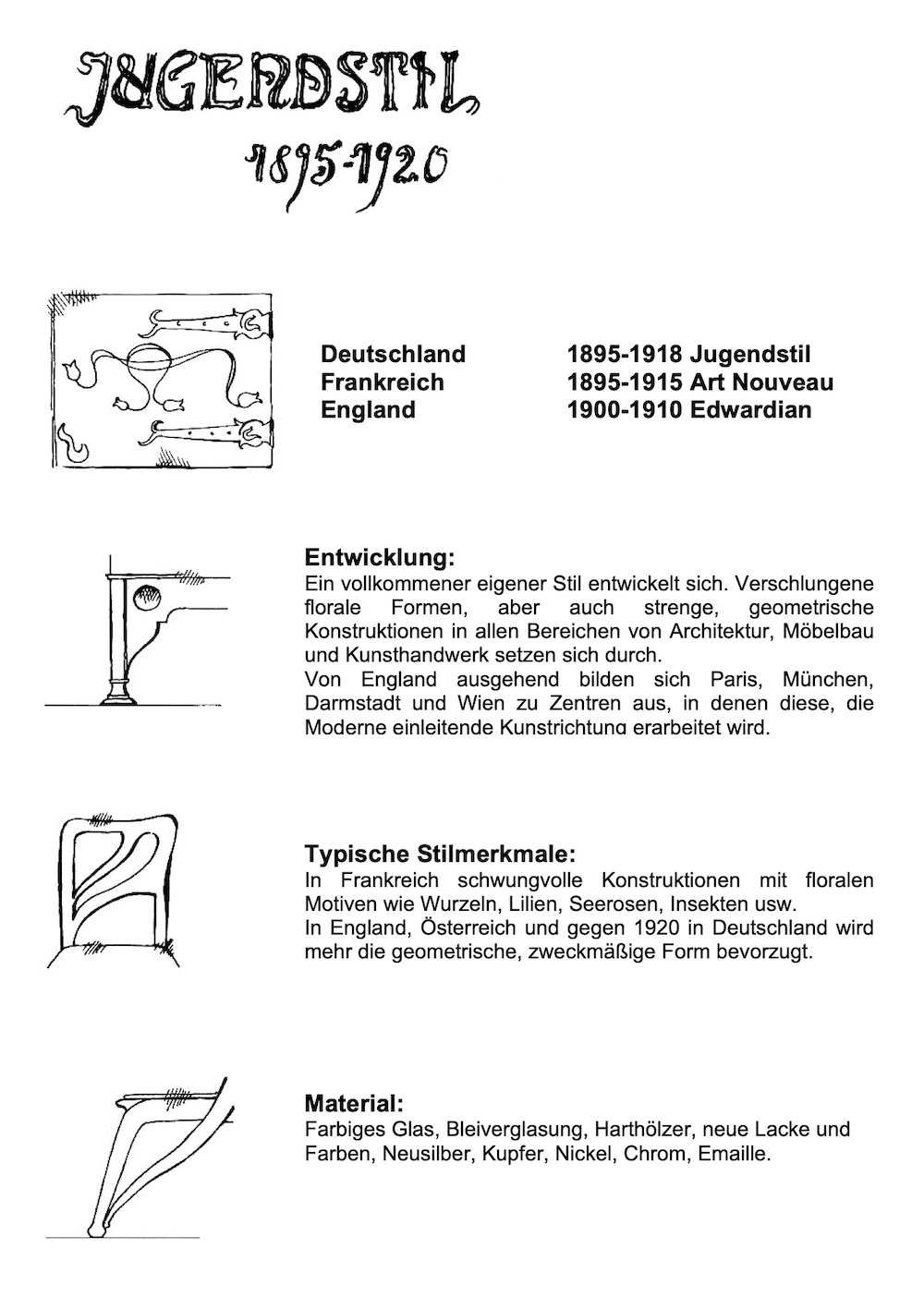
Alle Stile der Vergangenheit sind einzigartig, aber unter all diesen Stilen ist wiederum der Jugendstil einzigartig. Alle anderen Stile sind Ordnungsbegriffe der Geschichtsschreibung: der romanische, der gotische, der barocke, der klassizistische Stil – diese Vorstellungen sind der historischen Betrachtung und Analyse zu verdanken, ihrem Bedürfnis nach Gliederung, Periodisierung, dem Wiedererkennen von Merkmalen, das nicht viel anders vorgeht als die wissenschaftliche Bestimmung von Pflanzen und Tieren. Der Jugendstil hingegen war als Stil gewollt, erstrebt, ja erfunden. Aber das ist nicht das Geheimnis seiner Einzigartigkeit.
Auch die historischen Wiederbelebungen, die einen Teil der Kunstgeschichte des 19.Jh. kennzeichnen, die Neogotik, die deutsche Neorenaissance, waren als Stil entdeckt, ergriffen und nachahmend in Bauten, Mobiliar, Lebensgesinnung in die jeweilige Gegenwart übertragen worden, und eben der Überdruss an solchen Repetitionen, der Ärger über die “Kostümierungen“ war ja eine der Triebkräfte, die den Jugendstil hervorgebracht haben. Er wollte und sollte ein Stil ohne Muster und Vorlage sein oder werden, ein ganz und gar neuer, eigener, zeitgenössischer, gegenwärtiger, lebendiger Stil.
“Hier ist das Neue, das wir endlich, endlich dem erdrückenden Erbe entgegenstellen können!“ – schrieb später der Maler Ahlers-Hestermann aus der Erinnerung an die Hochgefühle solchen Anfangs. Er erwuchs aus der Abkehr von den historischen, rekapitulierenden Stilen, doch nicht vom Stil überhaupt. Auch das Neue sollte und wollte nicht allein Stil haben, sondern ein Stil sein und das hieß – ganz im Sinne jener Ordnungsbegriffe der geschichtlichen Betrachtung – ein System von Formen, Gehäusen und Geräten, Zeichen und Gestalten, eine Kunstwelt, die sich eben derselben gegenwärtigen Lebenswelt aufprägen würde, die sie doch zugleich auszudrücken bestimmt war. So hat der Jugendstil, in dem er die Tradition beiseite warf, im Innern doch die Bestrebung, das Leben mit Kunstformen zu durchdringen und zu überziehen, die aus ein- und demselben Geist erwachsen, an spezifischen Merkmalen zu erkennen sind. Ein Formenvorrat würde es abermals sein, wie ehedem der gotische oder derjenige der Deutschen Renaissance, nun aber ein neu und frei erzeugter. Daher auch rührt der ausgreifende Universalismus, der so viele jener Neuerer, Mackintosh und die Seinigen, Henry van de Velde vor allem, auch Olbrich und Peter Behrens beflügelte: Maler, Kunsthandwerker und Architekten zugleich waren oder wurden sie, weil sie nicht nur in einem Beruf oder Bereich, sondern überall den Stil ausbreiten wollten, den sie erst schufen. Eben darum und nur darum war es Stil. Andernfalls wäre es entweder Malerei, oder Baukunst, oder Tischlerei, oder Weberei, oder was immer gewesen oder geblieben, nicht aber leben-umfassender, leben-erneuernder, leben-erhöhender Stil.
Die große Befreiung führte auf diese Weise gleichsam vom ersten Tag an auch ein Verhängnis mit sich. Die alten Stil-“kostüme“ waren abgeworfen, aber man stand nicht nackt, sondern zog sich zugleich ein neues über. Die Emanzipation verfing sich im Netzwerk ihrer eigenen Hervorbringungen. Die den neuen Stil schufen, verwickelten sich buchstäblich im Gespinst ihrer Erfindungen. Das beispiellose Unternehmen der Stilschöpfung lief auf eine Selbstverwandlung, die Befreiung auf eine Verzauberung hinaus.
Denn worin man auch immer das Hauptmerkmal des Jugendstils erblicken mag, so weit er sich in der Bildenden Kunst einschließlich der Architektur und der verschiedenen handwerklichen Disziplinen zu erkennen gibt – in der Belebung der Fläche, in der Kultivierung der dynamischen Linie, in der Herrschaft des Ornaments oder in dem allen zugleich: diese Füllungen und Aussparungen, diese Schwarz-Weiß-Vertauschungen. Diese rahmenden Umschlingungen, diese Wellen, Locken und Wurzeln, diese Erweichung der Tektonik, diese Asymmetrien, diese Kurvaturen, diese fliehenden und sich vereinigenden Seelenleiber, diese plastisch-blasigen Räume, diese Leere und dieser sparsame Prunk, diese Verquickung des Organischen und Funktionellen, diese Verdrängung der Horizonte und diese Fesselung der Gestalt in ihrer Kontur – das alles ist wie ein einziger Zauberbann, der um sich greift, dem nichts zu entgehen scheint, vom Buch und Bild bis zum Haus und Garten, vom Pflaster bis zum Turm, von den Möbeln bis zum Geschirr und Besteck, zu den Gewändern und zur Buchstabenschrift.
Ein sanfter, süchtiger Taumel, eine frohe Besessenheit. Der Trieb der Stilisierung lässt die menschliche Person, Erscheinung, Gebärde, Sprachen nicht aus, die neue Autonomie schafft sich ein artifizielles Gefängnis. Wie in einem Kokon von Kunst bewegt sie sich. Die Produktivität dieser Jahre um die Jahrhundertwende ist hinreißend, die Epoche leuchtet und glitzert vor Selbstgefühl und Zuversicht, und doch rührt und inmitten solcher Schönheit, die überall regieren soll, die Ahnung des Verfalls an, die aus ihr entgegenscheint. Denn das Schöne ist nichts als der Anfang des Schreckens – in manchem Sinne auch hier.
Freilich fällt auch kein Stil, kein Formenschatz vom Himmel, auch nicht vom Himmel des Genies. Auch das überraschend Neue führt ältere und alte Spuren mit sich, saugt Vorbilder an, verarbeitet Tradition, entdeckt mit frischem Blick, was verschollen war oder von fern her kam. Die große japanische Anregung ist offenkundig in der Graphik Aubrey Beardsleys, des Wunderkindes; in den Plakaten von Toulouse Lautrec, des Kenners der Cafés und Cabaretts; ja in den Gemälden Vincent van Goghs, dem man einen Christusmenschen genannt hat.
Die erste Wahrnehmung des japanischen Farbholzschnittes ist genau datiert worden, ein französischer Stecher war der früheste Bewunderer, das war schon 1856. Und auch der Weg, den diese Begeisterung genommen hat, die Ansteckung der Augen ist erforscht, der Maler Whistler trug das Virus nach London. Nicht weniger deutlich tritt diese Spur zu Tage, wenn wir erfahren, dass der Kunsthändler Samuel Bing aus Hamburg – dessen Pariser Geschäft den Namen “Art Nouveau“ trug und den Begriff damit zum Kennwort machte – als Japanhändler angefangen hat und seit 1888 einen japanischen Formenschatz herausgegeben hat, den er den Künstlern empfahl.
Von daher stammt die Zuwendung zur reinen Fläche, das gleichsam schreibende Zeichnen, das die Tiefenperspektive, die Kulissenordnung, die Illusion der Körperlichkeit von Licht und Schatten und den Erd- und Himmelshorizont, all diese abendländlichen Errungenschaften verwirft.
Auch der Geschmack am leergelassenen Zentrum, der “amor vacui“ – wie ein geistreicher Historiker es genannt hat – und das Wegrücken der festen Elemente, sowohl der graphischen Arbeit als auch des möblierten Raumes, an die Ränder. Der bedeutendste Holzschnittmeister der Epoche, Félix Valloton, weit derber in Sujet und Manier als Beardsley – dem ich ihn gleichwohl an die Seite rücken möchte – lässt die japanische Imprägnierung nicht minder deutlich wiedererkennen als dieser. Man könnte sogar vermuten, dass der hohe Wert und der entschiedene Klang, der dem Wort Dekoration in jenen Jahren zukommt – während es nachmals und bis heute beinahe ein ästhetisches Todesurteil ausspricht -, von der Anschauung japanischer Erzeugnisse mitbestimmt war.
Die Frage des Niveaus, des Formats, der künstlerischen Qualität von Werken, die dem Jugendstil zugerechnet werden, habe ich bisher ausgespart. Wenngleich der Markt seit etwa 30 Jahren durch eine völlige Neubewertung und eine zuvor ungeahnte Schätzung gekennzeichnet ist, scheint das alte Global-Verdikt doch bei Erzeugnissen der hohen Kunst noch nachzugeistern. Die Kenner mögen vielfach nicht gern hören, dass Bilder etwa von Munch oder van Gogh Jugendstilzüge aufweisen. Bei Klimt oder Stuck ist man nachsichtiger.
Die Großen, so heißt es, sollen doch herausragen aus der Signatur der Zeit, wenigstens mit halbem Leibe. Niemand scheut sich, Tiepolo einen großen Barockmaler zu nennen, das Epochenmerkmal verbindet sich hier ohne Schwierigkeit mit dem der Größe. Im Falle des Jugendstils spürt man eine Hemmung, seine Meister scheint es, können nicht eigentlich groß sein, und wenn sie groß sind, so hält man sie besser aus der Kategorie Jugendstil heraus. Die Empfindung lässt sich bestimmt erklären: die Einzigartigkeit dieses Stils, dass er nämlich als ein solcher gewollt war (wovon hier eingangs die Rede war), scheint der Unterscheidung der Werke nach ihrem Rang, scheint zumal der Zubilligung von Größe, hoher Schönheit, bedeutender Kraft im Wege zu sein.
Der allgemeine Reiz ist längst entdeckt, tausendfach wahrgenommen oder nachgeschmeckt, das unbefangene Kunsturteil jedoch scheint wie abgeklemmt, sobald die Zuordnung zur Sphäre Jugendstil den Geist und das Auge beherrscht.
Diese Klammern sollten zu lösen sein. Edward Munch ist ein großer Jugendstilmaler, vielleicht der größte und vielleicht gerade deswegen, weil er allein das Verhängnis dieser Verzauberung dargestellt hat, den Fluch im Bann. Beardsley, Valloton sind geniale Jugendstilgraphiker; Mackintosh, van de Velde, auch Olbrich: mächtige und originale Architekten und Universalisten des Jugendstils – und innerhalb des Jugendstils, mag van de Velde in seinem Selbstbewusstsein das auch von sich gewiesen haben. Wir kleben ihm damit nicht ein Etikett auf, sondern wir weisen auf die Signatur seiner Formenwelt hin, ohne im geringsten die individuellen Ausprägungen zu verwischen.
Richard Riemerschmid hat die schönsten, zartesten Jugendstilmöbel und –geräte entworfen; auch dieses Exempel soll erwähnt sein, denn von Meisterwerken der angewandten Künste müssen wir nicht darum geringer denken, weil uns der Traum des praktischen Gesamtkunstwerks vergangen, die Lebenssynthese zerfallen ist, die im und mit dem Jugendstil gemeint war.
Mäßige und miserable, wüste und geschmacklose Beispiele will ich nicht nennen. Unterscheidung ist geboten auch im Falle des Jugendstils – und, sozusagen, dem Jugendstil zum Trotz.
ART DECO
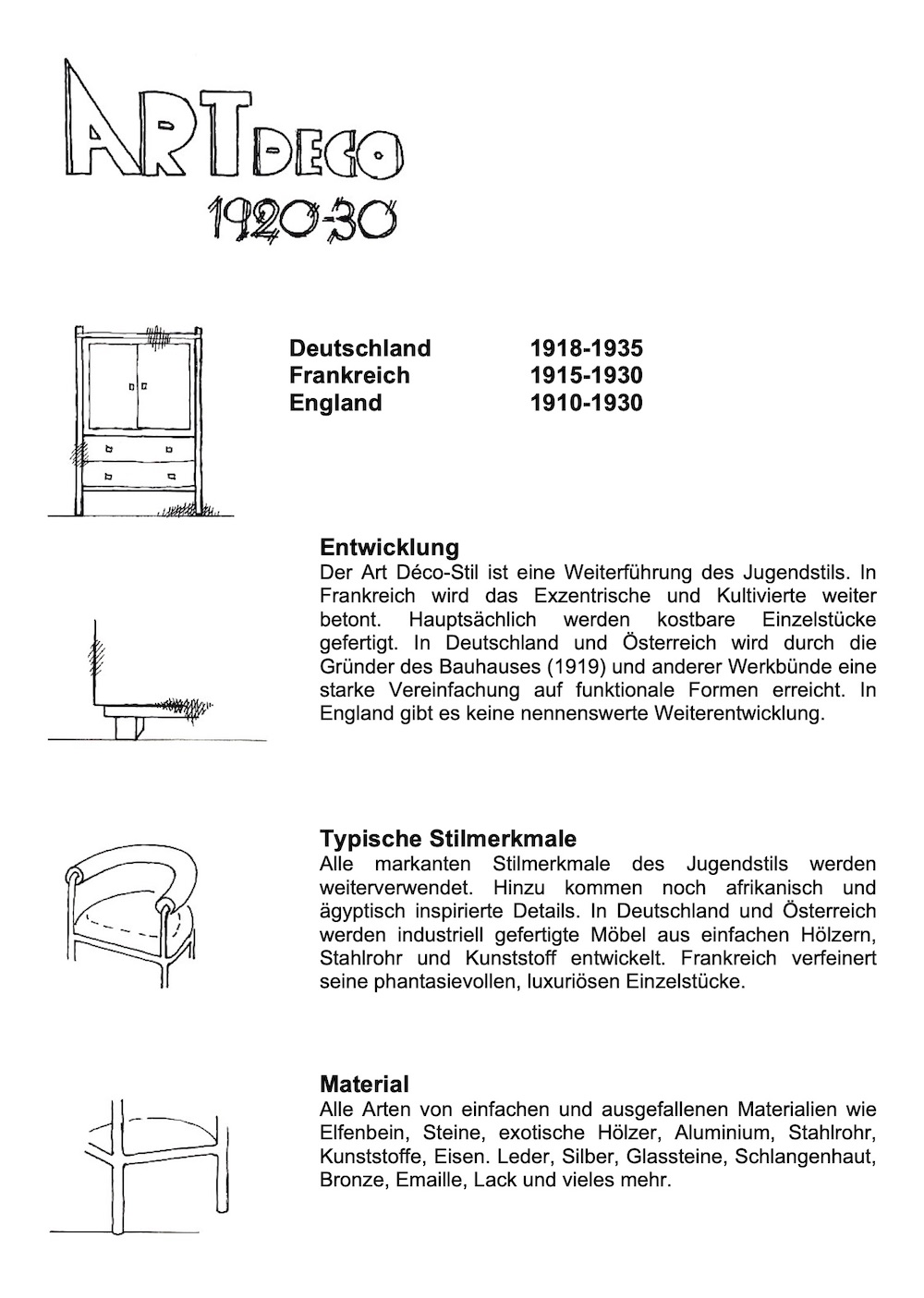
Aufbruch in die Moderne
Wieso “Moderne“? Gab es in der Vergangenheit nichts “Modernes“? Moderne heißt doch “modisch, dem Zeitgeschmack entsprechend, zeitgemäß“. Was hat der Übergang zum zwanzigsten Jahrhundert, das die vorangegangenen Jahrhundertwenden nicht hatten? Warum die Sonderstellung für das Jahrhundert, in dem wir leben? Die Kunst des ausgehenden 19.Jh., ermüdet vom Epigonentum der Gründerjahre, will nicht nur “modern“, sondern “absolut modern“ sein. Diese Modernität ist keine gefühlsmäßige Entwicklung, sondern ein durchdachtes, verstandesmäßiges Projekt – und das ist neu. Um sich jeglicher Beeinflussung durch die Vergangenheit zu entziehen, ist es der erklärte Wunsch der Künstler, mit allen bisherigen Traditionen zu brechen.
Den zweiten Schritt vollziehen die Künstler der sogenannten “historischen Avantgarde“, die um die Jahrhundertwende wirken. Sie streben danach, der Kunst an sich mit neuen, künstlerischen Mitteln eine neue Zielsetzung zu verleihen. Der Kubismus des Georges Braque und Pablo Picasso sowie die Künstler des "Blauen Reiter“ wirken so als Wegbereiter der abstrakten Kunst. In ihr vollzieht sich der vollständige Wandel des Verhältnisses zwischen Realität und Darstellung.
Der erste Weltkrieg, der die Völker mit Angst und Schrecken überzieht und alles zu vernichten droht, wirkt wie ein Katalysator auf diese keimende Gedankenwelt. Die Menschen schrecken auf wie aus einer Trance. Was ist mit uns geschehen? Die Bedrohung der Existenz eröffnet eine neue Perspektive auf Leben und Kultur. Das menschliche Dasein wird analysiert, und man beginnt, es auf vielerlei Gebieten neu zu bewerten.
Fazit: In allen gesellschaftlichen Bereichen, ob Politik, Kunst, Musik oder Lebenskultur muß umgedacht werden.
Die Jahre zwischen den Weltkriegen
Eines ist klar: Die aus dem Verstand, nicht aus dem Gefühl geborenen neuen Ideale haben ein weitaus größeres Gewicht als das, was im allgemeinen mit dem Zeitgeist der “Goldenen 20er Jahre“ assoziiert wird: eine ausgelassene, feine junge Gesellschaft, die Damen in Charleston-Kleidern, kecken Hütchen und behängt mit langen Perlenketten, die, das Schampusglas in der Hand, das Tanzbein zu Jazz-Rhythmen schwingen... Gewiss ist diese überschäumende Lebenslust Ausdruck eines Neubeginns – rückblickend wirkt sie jedoch fast apokalyptisch. Was wirklich zählt, sind die Gedanken und Taten, die über ihre Entstehungszeit hinaus Bestand haben und selbst einen “Vernichtungsversuch“ der Diktatoren überleben. Diese geistig-künstlerische Entwicklung der Weimarer Kultur geht dabei Hand in Hand mit der politischen Republik.
Politische Ereignisse der 20er Jahre
Die Anfangsjahre der Weimarer Republik sind geprägt von revolutionären Unruhen, deren Auslöser Aufstände der Arbeiter und Soldaten sind. Da Kaiserreich und adelige Führungsschicht die Niederlage des ersten Weltkrieges zu verantworten haben, soll nun das Proletariat Fundament einer demokratischen Räterepublik werden. Bezeichnend ist auch die Entstehung, Zersplitterung und Umgruppierung der zahlreichen politischen Parteien. Die rechts- und linksradikalen Gruppen lehnen die Räterepublik ab, was sich in politischen Morden und Putschversuchen niederschlägt. Die Turbulenzen im Innern, gekoppelt mit außenpolitischen Problemen, die im Anschluß an den Versailler Friedensvertrag vom 28.Juni 1919 entstehen, bringen schließlich die Volkswirtschaft zu Fall. Inflation und Arbeitslosigkeit treffen vor allem die Mittel- und Arbeiterschicht. Als 1923 französische und belgische Truppen ins Ruhrgebiet einmarschieren, kann Reichskanzler Wilhelm Cuno nur noch zum passiven Widerstand aufrufen, was jedoch erfolglos bleibt.
Unter Gustav Stresemann gelingt dem “Kabinett der großen Koalition“ endlich die Währungsstabilisierung. Es geht aufwärts. Durch strikte Rationalisierung und Anleihen im Ausland kann die Lage gefestigt werden. Im Frühjahr 1924 darf die junge Republik erstmals nach langen, harten Kämpfen endlich aufatmen.
1928 bildet sich unter Hermann Müller noch einmal eine große Koalition. Jedoch haben sich zwischen Rechts und Links so große Spannungen aufgebaut, dass diese nicht mehr geräuschlos abgebaut werden können. Der “Schwarze Freitag“ an der Wall- Street bringt ein Jahr später eine Lawine ins Rollen: die Weltwirtschaftskrise. Wieder bedrohen existenzielle Nöte die Bevölkerung.
Über der Frage nach de Beiträgen zur Arbeitslosenunterstützung bricht 1930 die Koalition unter Müller auseinander. Drei Jahre lang sind die Parteien unfähig, eine verfassungsgemäße Regierung zu bilden. Die Präsidialregierung, die daher zum Einsatz kommt, bringt ständig Neuwahlen mit sich, die sich als Nährboden für die NSDAP erweisen. Bereits im Juni 1932 ist sie die stärkste Partei. Die Parteien der Mitte schmelzen, KPD und NSDAP denken nicht daran, eine Koalition einzugehen. Am 22. Januar 1933 erteilt Paul von Hindenburg seine Zustimmung zur Berufung Hitlers als Reichskanzler.
Künstlerische und kulturelle Entwicklung der 20er Jahre
Die politischen Ereignisse prägen die Kultur der Menschen. So können den Entwicklungsphasen der Republik kulturell bedeutende Abschnitte gegenübergestellt werden. Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges eskaliert die übersättige bürgerliche Ordnung. Der Weg ist frei – frei für all das Neue, das bereits um die Jahrhundertwende zu brodeln begonnen hatte. Wie ein Vulkan bricht der neue Geist überall hervor: die politische und künstlerische Revolution.
So verschieden wie die Künstler sind auch die Wege, die eingeschlagen werden. Alle sind sich bewusst, dass die Gesellschaft an diesem Punkt nicht stehen bleiben darf. Gedankliche Kreativität ist das Gebot der Stunde. Die in dieser Zeit rasch aufeinanderfolgenden, als “Moden“ zu bezeichnenden Strömungen sind Zeichen der Aktivitäten, die jedoch noch ohne definitives Ziel sind. Die Künstler erhalten durch ihr mannigfaltiges politisches Engagement eine neue gesellschaftliche Position: Sie sind nicht mehr “bloße“ Ästheten, sondern Intellektuelle.
Vorreiter und Mistreiter dieser jungen Rebellion sind die expressionistischen Künstler, die in nahezu allen kulturellen Bereichen zu finden sind: darstellende Kunst, Architektur, Literatur, Musik, Theater, Film. Typisch für die expressionistischen Maler wie Ernst Ludwig Kirchner, Karl Schmitt- Rottluff und Erich Heckel, die sich 1905 in Dresden zur “Brücke-Vereinigung formieren, ist die Technik des Holzschnittes. Sie ermöglicht sowohl eine übersteigerte Formgebung als auch intensive Farben. Mit allen Mitteln soll der Ausdruck gesteigert werden.
Ein literarisches Dokument der expressionistischen Phase ist die von Kurt Pinthus 1919 herausgegebene “Menschheitsdämmerung“. Als wohl bekanntester politischer Dichter sei Ernst Toller genannt, der in der Haft die Werke “Masse Mensch“ (1920), “Maschinenstürmer“ (1922) und “Der entfesselte Wotan“ (1923) schreibt. Neben dem Theater, wo Max Reinhardt bereits vor 1914 die “desillusionistische Bühnentechnik“ inszeniert, und der Zwölftonmusik eines Arnold Schönberg und Alban Berg gewinnt auch ein junges Medium an Bedeutung: der Film.
Die Filmproduktion erstreckt sich auf politische Propagandafilme, wofür 1917 von der obersten Heeresführung die UFA gegründet wird, sowie auf Unterhaltungsfilme, die einen hohen zeitkritischen Wert repräsentieren. Bis in unsere Tage bekannt sind “Das Kabinett des Dr. Caligari“ (1919), “Dr. Mabuse“ von Fritz Lang und Friedrich Wilhelm Murnaus “Nosferatu. Ein Symposium des Grauens“ (1922). Die in diesen Filmen auffallend oft auftauchenden Tyrannenfiguren stellen die Unaufhaltsamkeit der Mächtigen dar. Ähnlich unseren heutigen Psychothrillern lösen sie Grauen aus, ohne eine reale Ursache aufzuzeigen. Sie bringen Gefühle auf die Leinwand, die sich im Unterbewusstsein eines jeden regen.
In vollkommenem Gegensatz zum emphatischen Expressionismus steht die Kunstrichtung des Konstruktivismus. Obwohl beide Richtungen aus den gegebenen gesellschaftlichen Umständen entstehen, entwickeln sie ganz unterschiedliche Konzepte, die die gesamte Spannweite der Kunst erfassen. Das Verdienst des im vorrevolutionären Russland aufkeimenden Konstruktivismus ist es, sowohl die profane Ingenieurkunst als auch die moderne Industrieproduktion in die, solange geweihten, Stätten der Kunst einzuführen. Möglich war dies auf einem Boden, der kaum durch klassisch-ästhetische Normen genährt war. Die Konstruktivisten wollen nicht mit dem Herzen, der Seele, sondern mit kühlem Kopf alle Kunstgattungen von den klassischen über Theater, Typographie und Buchkunst bis hin zu Fotografie und Film in allgemeingültigen, auf die Gesellschaft bezogenen Formen zum harmonischen Gesamtkunstwerk vereinen.
El Lissitzky ist der Prototyp und Wegbereiter dieses Stils: Architekt mit eigenem Ingenieurbüro. Kein Wunder, dass die geometrischen Gesetze der Architektur bestimmend für diesen Stil werden.
Das Zentrum des Anfang der 20er Jahre erwachsenden Konstruktivismus sind die Höheren-Künstlerisch-Technischen Werkstätten Moskaus. Noch im selben Jahr macht Lenin diesen Künstlern einen Strich durch die Rechnung. Im Zuge seiner “Neuen ökonomischen Politik“ ist Kunst nur mehr für Propagandazwecke zugelassen; - und Stalin wird später die Revolutionskunst schlicht verbieten. Was also bleibt, als auf politisch ungefährlichere Gebiete wie Plakate, Buchumschläge, Illustrationen und Werbegrafik auszuweichen?
Eine wichtige Lücke wird den Unterdrückten gelassen: internationale Ausstellungen. Mit einer solchen, 1922 in der Berliner Galerie van Diemen ausgerichtet, gelingt die Verbreitung der neuen Ideen in Europa. Vor allem in Polen, Ungarn und Deutschland werden sie begeistert aufgenommen. Der Westen Europas gerät dagegen in den Einfluß der holländischen “De Stijl-Gruppe, die, wie ihre gleichnamige Zeitschrift, 1917 an die Öffentlichkeit tritt. Zwar beansprucht auch “De Stijl“, universalistisch zu sein, aber mit der Industrie wollen ihre Vertreter nichts zu tun haben. Ihre Grundsätze sind philosophischer Natur. Der holländische Theosoph Schoenmaekers hat sich in der “Lehre von der mathematischen Struktur des Universums“ veröffentlicht. Der stark vom synthetischen Kubismus des Jahres 1912 beeindruckte Piet Mondrian ist der führende Künstler der Gruppe. Aufgrund seiner calvinistischen Erziehung fließen bei ihm puritanische Gesinnung und mystisches Pathos in die Gestaltung ein.
Während des Ersten Weltkrieges findet Mondrian in Holland Gesinnungsgenossen wie den Architekten J.J.P. Oud, den Maler Theo van Doesburg und andere Dichter, Architekten, Künstler, die sich dann in einer unpolitischen Gruppe formieren. Sie begreifen das Kunstwerk als Sichtbarmachung der von Gott geordneten Welt. 1920, auf dem Höhepunkt des Konstruktivismus, gibt Mondrian seiner Malerei den Namen “Neoplastizismus“. Seine Kompositionselemente sind auf die Farben Rot, Blau, Gelb, außerdem Schwarz, Grau und Weiß und auf streng geometrische Ausdrucksformen beschränkt. Vor allem die revolutionäre Erkenntnis, durch Asymmetrie zur Harmonie, zu einem kompositionellen Gleichgewicht zu gelangen, wirkt auf die holländische Architektur. Aber auch das Neue Bauen, die Typographie, die Gebrauchsgrafik sind den konstruktivistischen Formneuerungen verpflichtet. Das in dieser Zeit gegründete Bauhaus nimmt ebenfalls Impulse des “Stijl“ auf und entwickelt sie.
Auf andere, radikalere Weise macht der Dadaismus auf das Dilemma der Menschheit aufmerksam. Dada “war nicht eine Kunstbewegung im herkömmlichen Sinne, es war ein Gewitter, das über die Kunst hereinbrach wie der Krieg über die Völker. (...) Es entlud sich ohne Vorwarnung in einer schwülen Atmosphäre der Sättigung und hinterließ einen neuen Tag. Dada hatte keine einheitlichen Kennzeichen wie andere Stile. Aber er hatte eine neue künstlerische Ethik, aus der dann, eigentlich unerwartet, neue Ausdrucksformen entstanden.“ So beschreibt Hans Richter in seinem Buch “Dada – Kunst und Antikunst“ diese provokative Künstlergruppe.
50er Jahre
