... / INFOTHEK / MEISTER DER MÖBELKUNST
MEISTER DER MÖBELKUNST
...

Carl Maximilian Mattern
Der Fall Thonet
Englische Möbel
Historische Möbelkultur auf dem Lande
Hohenloher Schreinertradition
Möbelhölzer
Intarsien-Kunst
Carl Maximilian Mattern – Aufstieg und Fall eines Würzburger Kunstschreiners der Barockzeit
Am 8. April 1745 lud die Würzburger Hofkammer den um den Titel eines Fürstbischöflich- Würzburgischen Hofschreiners nachsuchenden Kunstschreiner Carl Maximilian Mattern vor und eröffnete ihm, "dass seinem ansuchen zwar gngst. willfahret worden, allein in dem fall er eine meisterhafte Arbeit in einem billigen und mit anderen Arbeitern gleichen Preys nicht liefern werde, die Bestellung bey einem andern gemacht, auch bewanden umständen nach Willkür gegeben werde“. In dieser Äußerung der Behörde sind Aufstieg und Fall eines der bedeutendsten fränkischen Kunsthandwerker der Barockzeit gleichermaßen beschlossen. Die Gewährung des begehrten Titels beinhaltete Anerkennung bisher erbrachter Leistungen, “worüber Ihro Hochfürstl. Gnaden nicht allein das gnädigste Vergnügen bezeiget“. Inbegriffen waren Privilegien, auf welche die Zunftkollegen nur mit Neid blicken konnten: Befreiung von der Jurisdiktion der Zunft, mit allen ihren aus der Nahrungsökonomie des Alten Handwerks erwachsenen Beschränkungen und Einengungen. Der Status eines Hofkünstlers setzte unerbittlich ein Höchstmaß an Leistung voraus. Vollendung in handwerklich- technischer Hinsicht, aber auch in Imagination und Form wurde gefordert, denn herrschaftlicher Anspruch des “vivre noblement“ hatte sich in jeglicher Schöpfung des Hofhandwerks zu manifestieren. Die bürgerlichen Zunftmitglieder konnten bei solchem Wettbewerb um hohe Leistung, höhere Bezahlung und allerhöchste Gunst nicht mithalten.
Aber auch außergewöhnliche Qualifikation konnte nicht verhindern, dass die Würzburger Hofkammer im selben Augenblick, in dem Carl Maximilian Mattern durch Ernennung zum Hofschreiner die oberste Stufe beruflichen Erfolges erreichte, den Meister mit “anderen Arbeitern“ seines Handwerks gleichsetzte. Nicht den Aufwand fürstlicher Repräsentation, dem das Wirken der Hofkünstler galt, vermochte die Behörde zu begrenzen, wohl aber die Kosten. Und solches ging zu Lasten der Handwerker. Eine “arbeit in einem billigen und mit anderen Arbeitern gleiches Preys“ war eine stete Gefahr für all jene, die wie Mattern für den Markt der “douceur de vivre“ tätig waren und mit dem Einsatz aller Mittel den höfischen Glanz, als Attribut des Staates, zu unterstreichen und zu mehren suchten. Die Gefahren konnten sich potenzieren, wenn finanziell nicht ausreichend abgesicherter geschäftlicher Wagemut hinzukam, wenn solcher Wagemut fehlschlug, weil fürstlicher Geschmack nicht richtig eingeschätzt wurde, wenn ein Wechsel der Regentschaft Zeiten der Restriktion heraufbeschwor und wenn zu alldem persönliche Schwächen, wie mangelnde Sparsamkeit und Neigung zum Nörgeln, den Weg ins menschliche und berufliche Abseits wiesen. Carl Maximilian Mattern blieb dies nicht erspart. Sein Ende war das eines Almosenempfängers, “stadtkündig“ erfüllt von Elend und Not.
Er wurde am 13. Januar 1705 in Nürnberg als Sohn des Kunstschreiners und Bildhauers Carl Mattern geboren. Seine Jugend verbrachte er in Wilhelmsdorf (Kreis Fürth), wohin seine Eltern zwischen 1709 und 1711 übergesiedelt waren. Die Lehrzeit beim Vater führte Carl Maximilian Mattern 1718 nach Schloss Pommersfelden und sodann in die Deutschordenskommende Frankfurt – Sachsenhausen. Die Stationen der sich anschließenden Wanderschaft sind nur lückenhaft zu benennen. Ein Aufenthalt in Mainz ist zu vermuten, eine Ausbildung bei Johann Jacob Arend in Koblenz- Pfaffendorf ist sicher zu belegen und die Vervollkommnung der vom Vater erworbenen Kenntnisse der sogenannten Boulle- Technik bei Johann Matusch in Ansbach dürfte wahrscheinlich sein. Vor 1730 kam Mattern, wohl von seinem Vater gerufen, nach Schillingsfürst (Kreis Rothenburg o. d. T), der Residenz des Grafen (seit 1744 Fürsten) Philipp Ernst zu Hohenlohe- Schillingsfürst.
Die Aussicht auf Übernahme der Werkstatt – hatte der Vater doch das 70. Lebensjahr schon überschritten – und die sich eröffnenden Entfaltungsmöglichkeiten im Dienst des Grafen waren Anreiz genug. Sucht man in Schillingsfürst nach Spuren der Hand Cal Maximilian Matterns, so zeigen sich nur Ansätze an untergeordneter Stelle. Einzelne Teile eines vom Vater gefertigten, aufwendig mit Messing und Zinn eingelegten Schreibschrankes sind dem jungen Kunstschreiner zuzuweisen. Die Hoffnung, nach dem 1730 erfolgten Tode Carl Matterns selbst solche Möbel schaffen zu können, war berechtigt, doch spitzten sich in der Folgezeit die familiären Ereignisse Carl Maximilian Matterns zu und gaben seinem Leben eine unvermutete Wende. Seine Nichte erwartete von ihm ein Kind. Die Trauung war bereits nach evangelischem Ritus vollzogen worden, da erklärte Philipp Ernst zu Hohenlohe- Schillingsfürst sie für ungültig und entließ darüber hinaus den Schreiner aus herrschaftlichen Diensten.
In seiner Auswirkung kam dies für Mattern einer Katastrophe gleich. Denn nach den Zunftbräuchen war er nun ein “Weibergeselle“ und musste der Ausstoßung aus dem Stand der Gesellen und ihrer Bruderschaft gewärtig sein. Die Möglichkeit, dem allem zu entgehen, bot einzig und allein die Tätigkeit als zunftbefreiter Handwerker im Dienste eines fürstlichen Herren. Carl Maximilian Mattern beschritt diesen Weg und wandte sich nach Würzburg, der Residenzstadt des Fürstbischofs Friedrich Karl von Schönborn. Er erwirkte den Dispens zur Heirat, wobei die Bedienung der Konversion kein Hemmnis für ihn bildete. Auf diese Weise konnte einer der bedeutendsten Kunstschreiner nach Würzburg; also keineswegs wie so viele seiner Künstlerkollegen angelockt von den Entfaltungsmöglichkeiten die der Bau der fürstbischöflichen Residenz bot. Matterns Anfänge in Würzburg waren mühevoll. Die Schreinerzunft, der die Anwesenheit eines “Weibergesellen“ alles andere als angenehm war, opponierte sofort gegen einen Aufenthalt in der Residenzstadt und ein 1733 Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn vorgelegter Entwurf zu einem Möbel scheint keine Approbation gefunden zu haben. Dass dennoch eine Wende zu einer günstigeren Entwicklung seiner Lebens- und Berufssituation eintrat, verdankte Mattern wohl dem einflussreichen Hofrat und nachmaligen Hofkanzler Franz Ludwig von Fichtel. Seiner Protektion dürfte die damals im Normalfall nicht zu leicht erreichende Übernahme des Schreiners in die fürstbischöflich- würzburgische Artillerie zuzurechnen sein, wo Mattern seit 1735 den Rang eines Feuerwerkes bekleidete. Wichtiger als diese finanzielle Absicherung – für die er im späteren Verlauf seines Lebens noch dankbar sein sollte – war die Tatsache, dass Mattern nun “qua feuerwercker die personal freyheit“ zustand, er damit dem Einfluß der Zunft und ihren Vorschriften entzogen war und ihm zudem die Möglichkeit zu umfangreicher Privattätigkeit in seinem erlernten Beruf eingeräumt wurde. Den Frieden mit den Berufskollegen besiegelte seine Aufnahme als Meister in die Würzburger Schreinerzunft, deren genaues Datum zwar nicht mehr zu ermitteln ist, die jedoch vor seiner 1736 zu verzeichnenden Annahme als Bürger der Stadt Würzburg erfolgt sein muss. Ein Zeugnis der Verbindung Carl Maximilian Matterns mit dem Hofkanzler Franz Ludwig von Fichtel hatte sich bis zum Stadtbrand Würzburgs am 16. März 1945 im Mainfränkischen Museum Würzburg in Gestalt einer Zimmervertäfelung aus dem Privatpalais Fichtels erhalten. Dabei setzte vor allem die gravierte Ahorn- Marketerie der Nussbaum- Füllungen des Lambris, der Türen und der inneren Fensterläden besondere Akzente. Mit jener um 1735 entstandenen Raumausstattung ging ein Interieur zugrunde, in dem sich die Bürgerkultur des alten Würzburg in ihrer nobelsten Weise präsentierte. Das Jahr 1736 brachte Mattern die ersten Aufträge von seiten des Hofbauamtes. Es waren Bauschreinerarbeiten in verschiedenen fürstbischöflichen Gebäuden. Auch wenn dies nur Broterwerb war, in de folgenden Jahren hatte Mattern schon bald seine anderen Würzburger Kollegen überflügelt, die sich mit kleineren Summen zufrieden geben musste. Doch konnten solche handwerklich untergeordneten Arbeiten den hochqualifizierten Kunstschreiner auf die Dauer kaum befriedigen. Er wurde deshalb 1739 bei dem Hofkammerpräsidenten vorstellig, dessen Fürsprache aber nicht den von Mattern erhofften Erfolg zeitigte. Der Meister ließ sich daraufhin offenbar hinreißen und kam prompt in Konflikt mit der Obrigkeit. Der Hofhafner Eder wusste von “gefallen sein sollenenden anzüglichen Reden gegen die Hofkammer“ zu berichten. Obgleich die folgende Untersuchung “nichts zuverlässiges“ erbrachte, eine missliche Auswirkung hatte die Angelegenheit für Mattern insofern, als man ihm die innerhalb des Residenzbereichs bis dahin zur Verfügung gestellten Räume kündigte und er “forthin anderstwo sich ein quartier ausmachen“ musste.
Carl Maximilian Matterns Tätigkeit für den privaten Beriech des Adels und des wohlhabenden Bürgertums entzieht sich leider vollständig der archivarischen Überlieferung. Doch vermag die Tatsache, dass der Meister zur Taufe seines Sohnes Carl Anton am 17. April 1738 im Würzburger Dom den Freiherren Anton von Massenbach als Paten gewann, etwas von den Kontakten anzudeuten, die Mattern mittlerweile pflegte. Ein um 1740 zu datierender Schreibschrank, der sich bis Ende des 19. Jahrhunderts in Würzburger Privatbesitz befand und dann im Erbgang nach Österreich gelangte, könnte für solchen Kundenkreis gefertigt worden sein. Es ist eine große “Trisur“ – so der zeitgenössische Ausdruck in Franken – mit vierteiliger Gliederung. Das Möbel wird geprägt von einer ungemein wuchtiger, gedrungenen, fast bedrängenden Körperlichkeit. Gravitätisch und schwer ist sein Stand. So kompakt das Gesamtvolumen auch ist, die Oberfläche ist außerordentlich lebhaft kurviert. Bauchungen und Einziehungen, sowohl horizontal als auch vertikal ausgebildet, gehen weich fließend ineinander über oder sind hartkantig abgesetzt, von Pilastern und Lisenen akzentuiert sowie von kleinteilig differenzierten Gesimsen abgegrenzt. Die Fronten sind in einem ataktischen Rhythmus bewegt, immer neue Spiegelungen leuchten wie bei Facetten auf.
Der künstlerische Durchbruch Carl Maximilian Matterns am fürstbischöflichen Hofe zu Würzburg erfolgte im Jahre 1741. Nach langen Jahren des Wartens wurde ihm erstmals ein Werk zugeteilt, bei dem er seine Qualitäten als Kunstschreiner unter Beweis stellen konnte. An Mattern ging der Auftrag für das Gehäuse einer Bodenstanduhr, zu dem der Bildhauer Georg Adam Guthmann die Schnitzereien schuf. Es ist jenes prachtvolle Werk, das sich heute im ersten Alexanderzimmer der Würzburger Residenz befindet. Nicht allein im Aufwand des geschnitzten und vergoldeten Dekors manifestiert sich der Anspruch der Arbeit, auch die Vielzahl der teilweise kostspieligen Hölzer unterstreicht den repräsentativen Charakter: Rosenholz, Mahagoni, Ebenholz, Nussbaum, Nussbaum- Wurzel, Birkenmaserholz und Ahorn sind in mannigfaltiger Weise verwendet. Ungemein feinfühlig sind die verschiedenen Maserungen und die unterschiedlichen Farbnuancen, die durch partielle Tönung des Pflanzen- Dekors zusätzlich bereichert wurden, zu einer abgestuften, harmonischen Gesamtwirkung genutzt. Die Marketerie kündet von überragender technischer Fertigkeit. Nicht allein die Fugenreinheit der Einlagen, auch die einem Kupferstecher zur Ehre gereichende Gravierung beansprucht höchste Bewunderung. In streng symmetrischer Anordnung überzieht den Grund ein lockeres Geflecht aus blattbesetzten Ranken, lanzettförmigen Blättern, Blüten, festen und aufgefächerten Muscheln sowie kurzen Bandformen. Vereinzelt erscheinen auch Rocaille- verzierte C- Bögen. Leichtflüssiger Kurvenschwung und grazile Dünnlinigkeit lassen bei aller vegetabilen Umformung aber doch den Bandelwerk- Stil als verpflichtendes Vorbild deutlich werden. Die Rocaille steht hier noch am Anfang ihres Lösungsprozesses aus Ranke und Blüte. Mit diesem Werk profilierte sich Carl Maximilian Mattern als führender Kunstschreiner Würzburgs und Frankens. Weitere Aufträge für die Residenz seines fürstbischöflichen Herren konnte er sicher sein.
Ein 1741 gefertigter Spieltisch aus dem Kabinett Friedrich Karl von Schönborns hat sich in der Würzburger Residenz erhalten. Zargen, Beine und Verbindungsstege sind prachtvoll geschnitzt und vergoldet, die von vergoldeten Messingrahmen gefasste Glasplatte ist mit einer hinreißenden Hinterglasmalerei geschmückt. Matterns Tätigkeit blieb allerdings auf die schreinerische Zubereitung des Werkes und die Koordination der beteiligten Künstler beschränkt. Der Hauptanteil fiel dem Hofbildhauer Johann Wolfgang von der Auwera zu, der nicht nur für die Schnitzarbeit sorgte, sondern dem auch der Entwurf der Hinterglasmalerei zuzuweisen ist. Ein Gegenstück zu diesem Tisch, das 1742 von Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn in Frankfurt Kaiser Karl VII. Albrecht überreicht worden war, tauchte 1911 im Frankfurter Kunsthandel wieder auf, wurde vom Landesgewerbemuseum Stuttgart erworben, jedoch 1937 dem Münchner Kunsthandel überlassen und ist seitdem verschollen. Am 23. November 1742 meldete Carl Maximilian Mattern der Würzburger Hofkammer die Fertigstellung eines Schreibschrankes, an dem er vier Jahre gearbeitet hatte. Begonnen in den Jahren des Misserfolges bei Hofe, suchte er mit diesem Möbel einen möglichst umfassenden Beweis seines Könnens abzulegen. In Zusammenarbeit mit dem Bildhauer Georg Adam Guthmann war ein Werk entstanden, das zu den Prunkstücken deutscher Möbelkunst zählt. Dieser Schreibschrank befindet sich nun im ersten Alexanderzimmer der Würzburger Residenz. Am 7. Dezember 1742 konnte Mattern den Empfang der geforderten 1600 Gulden quittieren; er war “von einem Hochfürstl. Bauambt krafft dieses Scheins zu danck völlig vergnüget worden“. Es konnte nicht ausbleiben, dass Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn den Schreibschrank und die Quittung Matterns zu Gesicht bekam, und es stellte sich heraus, dass er von der Auftragsverteilung überhaupt nichts wusste. Die Maßregelung, welche die zuständige Behörde über sich ergehen lassen musste, ließ nichts an Deutlichkeit vermissen. Der Regent lehnte zudem die Übernahme des Möbels ab, wobei er neben formal- rechtlichen Gründen ins Feld führte, dass Matterns “forderung nicht allein ohngemein kostbar ist, sondern ich sehe keinen Platz, wo diese machine könne hingestellt und gebrauchet werden“. In der Folgezeit entschloß er sich aber doch, den Schrank zu übernehmen, denn der Schreiner war ohnehin vom Bauamt worden.
Es ist ein mächtiges Möbel, das eine ungeheuer füllige Wucht und würdevolle Schwere kennzeichnet. Seine pompöse, durch die vergoldete Ornamentik üppig, fast aufdringlich unterstrichene Grandezza resultiert aus dem schwerblütigen Fluss der Gesamtform, nicht jedoch aus der Bewegung der Einzelteile. Hier entfaltet sich in den Oberflächen ein Spiel, dessen horizontal und vertikal fließendes In- und Auseinander an ein von ordnender Hand gestaltetes, kunstvoll aufgebautes Gebirge erinnert. In der bildnerischen Grundhaltung Matterns ist das Körperhafte seines Werkes, das Gefühl für das Anschwellen und Abebben einer Fläche, das lebensvolle Atmen eines vielteiligen Organismus begründet. Solches Leben findet seine Resonanz in der originalen Raumausstattung mit goldverzierter Lambris und sattfarbigen Tapisserien, welche die flimmernden Oberflächen des Möbels in die Bewegung der Umgebung einbetten. Dass Friedrich Karl von Schönborn das Möbel Matterns, dessen Vorbild sich in Gestalt eines nun in den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums Schloss Köpenick zu Berlin sich befindenden, aus Koblenz stammenden, Schreibschrankes Johann Jacob Arends genau benennen lässt, so geringschätzig als “machine“ abqualifizierte, war nicht zuletzt in der Existenz weiterer, ähnlich gewaltiger Stücke in der Würzburger Residenz begründet. Diese von den Vorgängern Schönborns in Auftrag gegebenen Stücke waren inzwischen hoffnungslos altmodisch geworden. Gefallen fanden bei Schönborn hingegen geschnitzte und vergoldete Möbel kleineren Formats, für deren Schaffung Zierschreiner und Bildhauer zuständig waren.
Carl Maximilian Mattern in der Einzeldurchbildung seines Schreibschrankes alles aufgeboten, um seine Qualitäten ins rechte Licht zu setzen. Von erlesener Kostbarkeit und Feinheit sind Wahl und Zusammenstellung der Hölzer. Die verschiedenen “bois des Indes“ aus Übersee waren damals teures Gut des Fernhandels und wurden nach Gewicht als “Pfundholz“ gekauft. Sie waren Zeichen der höfischer Kultur, bei denen exquisite Verarbeitung unabdingbar war. Hier entfaltete sich, ebenso wie in der Mahagoni- Marketerie, Matterns wahrlich überragende handwerkliche Meisterschaft, die ihn als einen der bedeutendsten deutschen Kunstschreiner ausweist. Carl Maximilian Mattern hatte mit der Übernahme des Schreibschrankes durch seinen fürstbischöflichen Herren scheinbar ein Wagnis bestanden. Dennoch begann für ihn damit, dass er naturgemäß von den internen Unstimmigkeiten nichts erfuhr, die Ungunst des Schicksals zu walten. Die Folgen sollten sich allerdings erst drei Jahre später zeigen.
Matterns Werkstatt, in der der Meister nach eigener Aussage 1742 nicht weniger als “12 und mehrere Gesellen zur Hofarbeith in Cost und Lohn“ hielt, war bei solcher personellen Größe nicht nur mit hochherrschaftlichen Aufträgen auszulasten. Arbeiten für den landsässigen Adel und das begüterte Bürgertum mussten ergänzend hinzukommen, also Schöpfungen für einen Kundenkreis, welcher der schriftlichen Fixierung seiner Aufträge in aller Regel nicht bedurfte und deren Identifizierung daher unüberwindliche Schwierigkeiten bereitet. Eine nicht geringe Zahl mehr oder minder einfacher, in unserer Zeit besonders vom Kunsthandel nur zu gerne pauschal nach Würzburg lokalisierter Möbel harrt vergeblich der Bestimmung seiner Meister, da einzig und allein als Richtpunkte für jene Ermittlung die archivarisch gesicherten, doch anderen Kriterien unterworfenen Stücke fürstlicher Repräsentation gelten können. Nur dort, wo die einfacheren Möbel der “bonne maison“ einen Reflex spezifischer Merkmale der benennbaren höfischen Werke zu erkennen geben, gelingt es, solche Arbeiten aus ihrer Anonymität zu befreien. Dazu gehörte ein um 1742/43 zu datierender Schreibschrank im Mainfränkischen Museum Würzburg, der leider im Feuersturm des 16. März 1945 verbrannte. Hier lässt sich auch das Gehäuse einer Bodenstanduhr im gleichen Museum anschließen; für eine Wiederholung, die sich nun im Bayerischen Nationalmuseum München befindet, zog man nach Ausweis der charakteristischen Marketerie um 1755/60 mit Franz Benedikt Schlecht den Konkurrenten Matterns zu. Größerer Aufwand entfaltet sich im Gehäuse einer weiteren, um 1743 von Mattern gefertigten Bodenstanduhr des Mainfränkischen Museums Würzburg (siehe nebenstehende Abb.). Übertroffen wird dies alles von einem für Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn geschaffenen Schreibschrank, für den Carl Maximilian Mattern im Jahre 1744 insgesamt 1540 Gulden erhielt. Das Möbel befindet sich noch in der Würzburger Residenz. Erdgebundene Fülle und behäbiger Zuschnitt des Korpus, volltönende Artikulation des Ganzen bei lebhafter Eloquenz des Einzelnen, dies sind Eigenschaften des Möbels, das seinen Meister unverwechselbar zu erkennen gibt. Die Einzelteile scheinen unter Missachtung jeglicher technischer Probleme wie von einer knetenden Hand modelliert zu sein, und die Schmiegsamkeit der Kurvaturen erfährt durch kontrastierende Bindung an die ungemein präzise geführten Gliederungs- Elemente eine nachdrückliche Steigerung. Im Verzicht auf eine ornamentale Marketierung der Schubladenfronten erweist sich Matterns feines Gespür für einen optimalen Einsatz der verfügbaren Mittel. Die prachtvollen, aus vergoldetem Messing bestehenden Griffe und Schlüsselschilder des Würzburger Hofschlossers Johann Georg Oegg waren für den Schreiner wahrlich genügend Anlass zu eigener Zurückhaltung. Solche Beschränkung ließ sich bei der großflächigen Mitteltür des Aufsatzes aufgeben, deren Außenseite Mattern mit einer hinreißenden Elfenbein- Marketerie schmückte.
Der Schreiner erweist sich hier als ein Ornament- Künstler besonderen Ranges, doch blieb bei ihm das Rokoko der symmetrischen Gebundenheit barocker Formvorstellungen verpflichtet. In der überragenden handwerklich- technischen Ausführung der Elfenbein- Einlagen und der Gravierung ist ihm in Franken nur noch der große Ferdinand Plitzner an die Seite zu stellen. Matterns Preise, auch für handwerklich untergeordnete Arbeiten, waren beträchtlich. Dies und das große Auftragsvolumen legen die Annahme nahe, dass es der Meister eigentlich zu einem gewissen Wohlstand hätte bringen müssen. Dem stand jedoch Matterns fatale Eigenschaft entgegen, im Umgang mit Geld keine glückliche Hand zu haben. Das Jahr 1745 sah Carl Maximilian Mattern auf dem Höhepunkt seines beruflichen Erfolges. Am 9. April 1745 wurde er zum Fürstbischöflich- Würzburgischen Hofschreiner ernannt, eine Würde, die er – ebenso wie seine Arbeit bei Hofe- allerdings mit seinem Konkurrenten Franz Benedikt Schlecht zu teilen hatte. Kaum hatte Mattern den Gipfel seiner Karriere erreicht, begann ein für ihn tragisches Schicksal seinen Lauf zu nehmen. Wieder hatte er ohne Auftrag ein ungemein aufwendiges Möbel gefertigt, mit dem er zu unterstreichen suchte, “dass die Hochfürstl. Gnad in ertheilung des Hoffschreiner Decrets, wo vor den unterthänigsten Danck hiermit zu Füssen lege, keinem unwürdigen zugewendet worden seye“ und mit dem er die Hoffnung verband, sich “in Höchsten gnaden zu setzen“. Es ist der sich heute im Mainfränkischen Museum Würzburg befindende Schrank.
Obwohl weder eine Bestellung von seiten des Fürstbischofs noch eine Zahlungsanweisung erfolgt war, hatte Mattern bereits eine Abschlagszahlung von nicht weniger als 500 Reichstalern erhalten. Als der Hofschreiner seinen fertiggestellten Schrank bei Hofe ablieferte, versuchte man daher, eine Besichtigung des Möbels durch den Regenten zu verhindern. Der empörte Meister, der sich das nicht erklären konnte, wandte sich daraufhin mit einer Eingabe direkt an Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn. Dessen Entscheidung vom 7. Oktober 1745 war jedoch eindeutig; man ließ Mattern wissen, “dass derlei machines zu der heutigen tags meublirung nicht mehr schiklich, also auch diese nimmermehr werde ahngenommen werde“.
Das Möbel unterscheidet sich im Aufbau von den vorherigen Werken Matterns. Auf den sonst stets zu findenden Sekretär- Teil wurde verzichtet. Der Untersatz hat die Form eines Tisches mit vier geschnitzten und vergoldeten Beinen; die Bildhauerarbeit stammt von Johann Wolfgang von Auwera. Die breite Tischzarge nimmt eine Schublade auf, in das Gesims ist eine herausziehbare Schreibplatte eingelassen. In das gewohnte Muster reiht sich hingegen der Aufsatz ein. Die opulente Wucht früherer Werke Matterns ist hier gedämpft, das Format intimer, doch eignet dem Möbel eine ernste Feierlichkeit, die gravitätischer Schwere nicht entbehrt. Die Stämmigkeit der Proportionalen findet ihre Erklärung in der auffallend kleinen, untersetzten Statur Friedrich Karl von Schönborns, die dem Schreiner Anlass gab, den Schrank “überhaupt der proportion nach wohl gestellt“ abzuliefern. Die Schweifung der Flächen ist, wie stets bei Mattern, ungemein bewegt und – besonders in der horizontal und vertikal reich differenzierten Kurvierung der Tischzarge – höchst kunstvoll. Erlesenheit und Verarbeitung der zur Verwendung gekommenen Materialien sind eines fürstlichen Kabinettschrankes wahrlich würdig. Die von Mattern in seiner Eingabe erwähnten “Cypressen Holtz, berlamutter, Helffenbein und messing“ umschreiben nur unzugänglich die ganze Palette der Werkstoffe, die zudem Rosen- und Ebenholz, Schildpatt, Kupfer, Nussbaum, Kirschbaum, Birkenmaserholz und Ahorn aufweist. Höchst delikat ist die verschiedenartige Zusammenstellung der Hölzer und ihr Zusammenklang mit den gravierten Elfenbein- Einlagen, ungemein preziös sind die fischgrätenförmig furnierten Rosenholz- Friese.
Der Stil des Rokoko ist in den Formen des Dekors nun voll zum Durchbruch gekommen. Der Betrachter bleibt im unklaren, was er mehr bewundern soll: die geradezu virtuose Technik, für die keine Fläche zu stark kurviert war, um sie nicht mit Einlagen schmücken zu können, die haarscharfe Fugenreinheit, mit der die unendlich reich aufgelösten, kleinteilig durchbrochenen Formen marketiert sind, die meisterliche Gravierung, die Schönheit der einzelnen Motive oder die spannkräftige Eleganz ihrer gegenseitigen Durchdringung. Es bedarf der mußevollen Vertiefung in das Detail, um sich bewusst zu werden, mit welch überzeugender Selbstverständlichkeit die unterschiedlichsten Dinge zu einem harmonischen Ganzen verquickt sind. Trotz aller formalen Auflösung hat jede Einzelheit durch übergreifende Bezugnahme auf ein exakt gespiegeltes Pendant ihren fest geprägten Stellenwert und gleitet nicht in das nur Spielerische ab. Die Ablehnung des Möbels, dessen Kosten Mattern vorfinanziert hatte, brachte den Schreiner in erhebliche finanzielle Bedrängnis. Nach dem Tode Schönborns wandte er sich daher am 13. Oktober 1746 an dessen Nachfolger Anselm Franz von Ingelheim; er wurde jedoch erneut abgewiesen.
Im August 1747 wurde er wieder vorstellig. Unter Hinweis auf “seinen mittellosen Zustand“ bat er, “ihn vor dem trohenden Untergang fürstmildest zu retten“. Die Hofkammer sah nun keine Chance mehr, die an Mattern ergangene Zahlung zurückzuerhalten, der Erwerb des Schrankes um einen möglichst “raisonablen Preis“ schien den Räten die beste Lösung. Mattern wurde rigoros im Preis gedrückt und musste mit 1000 Talern, der Hälfte seiner ursprünglichen Forderung, zufrieden sein – sein geschäftlicher Ruin war nur noch eine Frage der Zeit. Die mangelnde Liquidität des Meisters führte zu einer beträchtlichen Schrumpfung des Unternehmens. Im Jahre 1748 ist nur noch von zwei Gesellen die Rede. Die personelle Besetzung der Werkstatt entsprach damit den Maximalvorschriften der Zunft, die von der Annahme ausgingen, ein Meister mit zwei ausgelasteten Gesellen und einem Lehrjungen könne sich eines bequemen Wohlstandes erfreuen. Ein Großbetrieb hingegen, wie ihn Mattern seither unterhalten hatte, schmälerte nach Ansicht der Zunftmitglieder das Brot aller Berufskollegen und war ihnen daher ein steter Dorn im Auge gewesen.
In die Zeiten der Vollbeschäftigung führte ein Auftrag zurück, den Carl Maximilian Mattern aus der Zisterzienserabtei Erbach erhielt. Abt Hieronymus Held gab um 1745 einen Schreibschrank in Arbeit, der heute im Graf von Luxburg- Museum Schloss Aschbach verwahrt wird. Ein zweites Exemplar dieser Art und gleicher Provenienz verbrannte 1945 im Mainfränkischen Museum Würzburg. Im Gegensatz zu jenen Stücken ist der ursprüngliche Besitzer eines weiteren Schreibschrankes, der sich nun in süddeutschem Privatbesitz befindet, nicht bekannt, doch dürfte angesichts der aufwendigen Gestaltung des Möbels ein nicht unbedeutender gesellschaftlicher Rang des Auftraggebers zu vermuten sein.
Matterns inzwischen beim Hofbauamt anstehende Schulden und seine kritischen finanziellen Verhältnisse führten den Schreiner allmählich ins Abseits. Hinzu kam seine Neigung zum Nörgeln, die ihn bei Hofe unliebsam werden ließ. Zu Reparaturarbeiten wurde er allerdings noch zugezogen, denn hier kamen seine Fähigkeiten in der sogenannten Boulle- Technik zum Tragen. In Würzburg besaß er als einziger Spezialist für Einlegarbeiten in Messing, Zinn, Silber und Schildpatt ein uneingeschränktes Monopol. Auch die bisher üblichen Bauschreinertätigkeiten nahmen ab; Matterns Konkurrent Franz Benedikt Schlecht gewann stark die Oberhand und zog nahezu alle Aufträge an sich. Eine Ausnahme bildet das prachtvolle Gehäuse einer Bodenstanduhr, die sich nun in der Sammlung Europäischer Wohnkultur des Fürstlichen Palais zu Wetzlar befindet. In der integrierten Tätigkeit des leider unbekannten Bildhauers bekundet sich ebenso ein besonderer, repräsentativer Rang des Werkes wie in der Arbeit des Schreiners. Hier lässt sich eine für hochherrschaftliche Verwendung bestimmte Schöpfung Carl Maximilian Matterns erkennen, auch wenn die Archivalien keine Erwähnung zu entnehmen ist. Seinen letzten großen Auftrag erhielt Mattern von der Prämonstratenserabtei Oberzell bei Würzburg. Für die im Erdgeschoss des 1753 vollendeten Konventbaus gelegene Sakristei schuf er einen aus zwei gleichartigen Teilen zusammengesetzten Doppelschrank, der 1936 in das Mainfränkische Museum Würzburg gelangte. Es ist ein mächtiges Möbel, durch dessen Doppelstellung sich die vertikale Tendenz des Einzelstückes zu imposanter Breitenwirkung verstärkt. Ein Wogen durchzieht die Front, von den oberen und unteren Gesimsen eingedämmt und den Schnitzereien des Würzburger Hofbildhauers Johann Wolfgang von der Auwera kräuselnd begleitet.
Die in den zeitlich vorangehenden Werken Matterns immer wieder zu beobachtenden Ansätze, von rhythmisiertem Zusammenspiel der einzelnen Möbelteile zu einem übergreifenderen, den ganzen Möbelkorpus erfassenden Bewegungsfluss zu gelangen, sind hier zu schönster Entfaltung gekommen. Die Gesamtwirkung entbehrt nicht der jegliche Schöpfung des Hofschreiners prägenden Schwere, beinhaltet jedoch nicht minder ein beträchtliches Maß an Eleganz.
Gegen Ende des Jahre 1754 wurde Matterns finanzielle Lage als hoffnungslos erachtet. Die städtischen Behörden zogen die Konsequenzen; “weilen der Hoffschreiner Matern totaliter verdorben ist, alß solle dessen steuer Rücksandt als Verlohren par ausgaab geführet, er auch pro futura außer anlag gelassen werden“. Auch die Hofkammer entschloss sich zu einem Schlussstrich und ließ Matterns Schulden als Ausgaben abbuchen.
Der Schreiner bestritt seinen Lebensunterhalt nun ausschließlich von seinem Sold als Feuerwerker bei der Artillerie; 1763 nahm er hier aus Altersgründen seinen Abschied. Ein Dasein in Armut und Elend ließ ihn zum Almosenempfänger werden, der 1767 nicht einmal die Kosten für seine Bekleidung aufbringen konnte. Einem Bittgesuch Matterns um eine neue Montur entsprach Fürstbischof Adam Friedrich von Seinsheim, “indem Ihro hochfürstl. Gnaden die armseelige Umstände des Supplicanten ebenso gnädigst bekennet, als stadtkündig seyen“.
Am 30. Mai 1774 verschied Carl Maximilian Mattern in Würzburg im Alter von 69 Jahren. Am folgenden Tage wurde er auf dem Friedhof von St. Burkard beigesetzt.
Mit ihm ging einer der bedeutendsten Kunsthandwerker dahin, die Frankens so überreiche Kunstlandschaft hervorgebracht hat. Die Tragik seines Lebens hatte ihm eine selbstständige Schaffenszeit von nur etwa zwei Jahrzehnten gelassen. Seine überkommenen Werke jedoch markieren Höhepunkte der Möbelkunst, deren Meisterschaft die Bewunderung unserer Zeit gilt.
Dr. Peter Trenschel
Mainfränkisches Museum
Würzburg
- Auszug aus 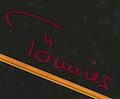 ANTIQUITÄTEN ALMANACH 1989/90 -
ANTIQUITÄTEN ALMANACH 1989/90 -
Der Fall Thonet
Historisch betrachtet, ist das 19. Jahrhundert geprägt durch den gravierenden Konflikt zwischen mechanischer Produktion und der traditionellen Handarbeit: Kunsthandwerk und Maschine. Es war auch das Jahrhundert der servilen Imitatoren aller möglichen traditionellen Stile der Massenproduktion von Formen, die für ganz andere Produktionsmethoden entworfen wurden. Erst gegen Mitte des vorigen Jahrhunderts versuchten einige Pioniere die Kluft zu überbrücken, die sich zwischen den verschiedenen Welten Produktion und Kunst auftat.
Ein Mann ragt dabei besonders eindrucksvoll heraus: Michael Thonet. Das Außergewöhnliche am “Fall Thonet“ ist, dass ihn der dramatische Konflikt zwischen Künstler und Maschine gar nicht berührt zu haben scheint. Von Anfang an hat er das Grundelement des Industrie- Design verwirklicht, dass Mensch und Maschine zwei Bedingungen sind, die, wenn sie sich ergänzen, harmonische Resultate zeitigen. Ein Konzept, das erst viel, viel später akzeptiert wurde. Aber der “Fall Thonet“ ist noch aus einem anderen Grund wirklich außergewöhnlich: Seine Möbel wurden nicht nur von seinen Zeitgenossen begeistert aufgenommen, sie werden bis heute mit großem Erfolg produziert und verkauft. Ein einzigartiges Phänomen: Ein Produkt bleibt über ein Jahrhundert unverändert, in einem Jahrhundert, dass alle Spielarten von “- ismen“ gesehen hat und noch sieht. Interessant ist, dass bei denen, die nach den Ursprüngen des modernen Design suchen, Michael Thonet als ein Genie galt.
Wegen seiner außergewöhnlichen Qualität ist er nicht einzuordnen und etwas außerhalb der Geschichte angesiedelt worden. Erst in neuerer Zeit setzt sich die Erkenntnis durch, dass es Thonet war, der den Weg geebnet hat zu wirklich originellen Formen, die in direkter Linie zu den funktionellen Modellen des Bauhauses führten.
Weniger ist mehr (Mies van der Rohe)
Nach dem großen Erfolg der für das Café Dom ( siehe Abb. Seite 523 ) in Wien entwickelten Stühle, versuchte Thonet unermüdlich, sein Konzept der dampfgebogenen Stühle immer mehr zu vereinfachen und zu vervollkommnen. Alle Konzessionen an das Nur- dekorative und Überflüssige wurden eliminiert. Das Resultat: der Stuhl der Stühle, der berühmte Thonet Nr. 14. Dieses Modell war so erfolgreich, dass schon bis 1930 über 50 Millionen davon produziert und in die ganze Welt exportiert worden sind. Nach einem Konzept, das erst viel später durch Mies van der Rohe berühmt gemacht wurde: weniger ist mehr.
Apropos Jugendstil
Vierzig Jahre vor den Linienführungen eines Van der Velde strahlten die gewundenen Linien in den Arbeiten Thonets eine Kraft und Sicherheit aus, wie sie später nur wenige Stücke der berühmtesten Jugendstil- Künstler erreichen werden. Einige der besten Seiten im Buche des Jugendstils wurden von Thonet geschrieben, lange bevor das Wort “Jugendstil“ überhaupt geprägt war.
“Ich wünsche keine Kunst für wenige, so wenig wie Erziehung für wenige oder Freiheit für wenige.“ (William Morris)
Interessant ist eine Gegenüberstellung der Welt Thonets du jener von Morris: Nicht, um den leidenschaftlichen Einsatz von William Morris zu verkennen – das ist klar -, sondern um zu unterstreichen, dass sich vielleicht ein wohltätiger Zweifel in seine mittelalterlichen Sehnsüchte eingeschlichen hätte, wenn der Idealist und Begründer der “Arts and Crafts“ die Leistungen Michael Thonets erkannt hätte. Vielleicht hätte er seine wohlbekannte Anti- Maschinen- Einstellung korrigiert. Und vielleicht hätte ihn das befreit von der fatalen Notwendigkeit, einer wirtschaftlichen Elite die Früchte einer Arbeit zuzugestehen, die – von ihm – der ganzen Menschheit zugedacht waren. Aber während Morris sich für eben dieses Ideal einsetzte, hatte Thonet schon ausreichend bewiesen, dass die Schuld der minderwertigen Industrieproduktion nicht bei der Maschine zu suchen ist.
Ein Modellfall industrieller Produktion
Die Bugholzstühle Michael Thonets sind so etwas wie ein Modellfall geblieben, wie die industrielle Revolution hätte aussehen können, denn kein Produkt des 19. Jahrhunderts hat die Erfordernisse und den Stil des industriellen Zeitalters so präzise vorweggenommen wie die klassischen Exemplare der Thonet´schen Bugholzstühle.
Das Biegen des Holzes
Bugholzmöbel werden aus Buchenholz gefertigt. Dieses Buchenholz wird zu Latten geschnitten und eine gewisse Zeit heißem Wasserdampf ausgesetzt, das Material wird gedämpft und damit biegsam gemacht. Diese gedämpften, geraden Buchenholzstäbe werden in Formen gebogen, in denen ein Stahlband eine Dehnung verhindert. In diesem gebogenen Zustand wird das Buchenholz getrocknet und anschließend durch mechanische Bearbeitung in die endgültige Form gebracht. Die Einzelteile werden nun durch Schrauben, also ohne Leim, miteinander verbunden. Das Endprodukt ist ein Stuhl, der durch seine Leichtigkeit, Elastizität und enorme Haltbarkeit besticht.
Le Corbusier und die neue Architektur
Fast als Manifest zeigte Le Corbusier den Thonet- Stuhl in seinem berühmten Pavillon de l´Esprit Nouveau 1925 in Paris. Le Corbusier zu seiner Wahl: “Wir glauben, dass dieser Stuhl, von dem Millionen gebraucht werden, auf dem Kontinent und in den beiden Amerika, Adel besitzt.“
Zwischen Rokoko und Rationalismus
Die Idee Michael Thonets war eine konstruktive, eine technologische Idee. Es war die Idee eines Mannes, dem es nicht primär um den Ausdruck künstlerischer Phantasie ging. Ihn faszinierten Material und Herstellungstechnik. Ihn faszinierte, dass er einen Stuhl jenseits aller Mode- und Zeitströmungen in großen Mengen fertigen konnte. Einen Stuhl für jedermann. Einen Stuhl, dem sein materialgerechtes Herstellungsverfahren seine hohe formale Qualität gab. Deshalb ist es ganz natürlich, dass es die Fabriken der Thonets waren, die dem rationalistischen Design den Weg aus dem engen Bauhaus- Kreis in die ganze Welt ebneten. Die Ideen, nach denen Mart Stam, Mies van der Rohe, Marcel Breuer und Le Corbusier ihre Modelle entwickelten, waren die gleichen wie die Michael Thonets. Und so schließt sich der Kreis zwischen Rokoko und Rationalismus. Thonet ging seinen Weg durch Neo- Klassik, Neo- Gotik, Arts and Crafts, Jugendstil und etablierte eine logische Verbindung zwischen alt und neu. Nicht nur Kaiser und Könige, Marlene Dietrich und Ernest Hemmingway saßen auf Thonet- Stühlen, auch im Hause Tolstois sind sie zu finden.
Fragen, Antworten, Meinungen
Industrielle Revolution und Michael Thonets Möbel aus gebogenem Holz
Die Leistungen der industriellen Revolution traten im 19. Jahrhundert zum ersten Male auf der internationalen Industrieausstellung in London in großartiger Weise i Erscheinung. Am 1. Mai 1851 wurde sie vor 25.000 Festgästen und im Beisein des englischen Königspaares eröffnet. Dieses Ereignis, das im hierzu von Joseph Paxton ganz aus Glas und Eisen erbauten “Kristallpalast“ stattfand, leitete das Zeitalter der Weltausstellung ein und rückte die Bedeutung der Weltwirtschaft, des Weltverkehres und der Weltindustrie in den Blickpunkt der öffentlichen und privaten Interessen. Ohne Zweifel waren “die Weltausstellungen in materieller wie in geistiger, in nationalökonomischer wie in sittlicher, in merkantilischer wie in rein gewerblicher Hinsicht von entschiedenem Einfluß auf die Wohlfahrt der Völker“.
Schon auf der ersten Weltausstellung war die Firma Thonet mit ihren Produkten vertreten. Sie wurde damals mit einer Preismedaille ausgezeichnet, stand aber zunächst noch ganz im Schatten der berühmten Wiener Möbelfirma Carl Leistler und Sohn, in deren Diensten Michael Thonet bei der Möblierung des Liechtenstein´schen Stadtpalastes in den Jahren 1842 – 1847 mitgeholfen hatte. Aber schon auf der Münchener Ausstellung im Jahre 1854 wurde der Firma Gebrüder Thonet die Ehrenprämie und im Jahre 1855 bei der Pariser Weltausstellung die Preismedaille erster Klasse zuerkannt. Den Höhepunkt erreichte sie mit ihren Exponaten für die dritte Weltausstellung im Jahre 1862 in London. Der illustrierte Katalog widmete Thonet eine ganze Seite mit Abbildungen, und Wilhelm Hamm, der Verfasser des Textes, sprach die Überzeugung aus, dass hier “eine Spezialität deutschen Gewerbefleißes vorliegt, wie sie das Ausland bis jetzt noch nicht zu bieten vermag. Daher sind auch die Stühle, Fauteuils, Sofas und Tische aus gebogenem Holz ein Anziehungspunkt für alle Kenner. Diese Arbeiten lösen mit Glück und Geschick ein Problem, an welchem schon viele Vorgänger gescheitert sind. Das Thonetsche Verfahren gibt den Gebrauchsmöbeln nicht bloß größere Leichtigkeit und Festigkeit, sondern erhöht auch deren Zierlichkeit, allerdings ist nicht zu leugnen, dass sich das Auge vorher an die neuen stabähnlichen Formen gewöhnen muss, deren gefällige Kurven an Gartenmöbel erinnern. “Bereits im Jahre 1830 hatte Michael Thonet mit der Erzeugung von Bugholzmöbeln begonnen. Im Jahre 1842 erhielt er von den allgemeinen Hofkammer in Wien das Privilegium, “jede, auch selbst die sprödeste Gattung Holz auf chemisch- mechanischem Wege in beliebige Formen und Schweifungen zu bringen“. Michael Thonet hatte in dem Staatskanzler Fürst Metternich einen begeisterten Protektor gefunden, der ihn auch veranlasste, aus Boppard am Rhein, wo er am 2. Juli 1796 geboren war, nach Wien zu übersiedeln. Hier kam es dann zu einem Arbeitsvertrag zwischen Carl Leistler und Thonet, den dieser im Jahre 1849 löste, um mit seinen fünf Söhnen ein eigenes Unternehmen zu beginnen. Im 1853 übertrug er ihnen das Geschäft und ließ es unter den Namen “Gebrüder Thonet“ protokollieren.
Nach 1848 setzte auch in Österreich die Industrialisierung mit aller Macht ein. Alle unternehmerischen Aktivitäten wurden von Staatswegen gefördert und unterstützt. Mit Hilfe der Maschinen gelang es, die Produktion in einem ungeahnten Ausmaße zu steigern. Die Folge war ein Wirtschaftswunder mit einem neuen Komfort und einem neuen Wohlstand, den nur die Großindustrie befriedigen konnte. Michael Thonet war einer der ersten Unternehmer, der im Jahre 1856 seinen Großbetrieb im mährischen Koritschan weitgehend mit Spezialmaschinen einrichtete, die eine Massenerzeugung garantierten. Hier gelang ihm dann die entscheidende Verbesserung seines Verfahrens, nämlich alle Möbelteile, selbst die schwierigsten Biegungen, ausschließlich aus einem massiven Holzstück herzustellen. Im Jahre 1859 ging dann aus der Koritschaner Fabrik jene Sesseltype Nr. 14 hervor, die mit 50 Millionen Stück bis zum Jahre 1910 der Hauptkonsumartikel der österreichischen Bugholzmöbel geworden ist. Gleichfalls in Koritschan entstand 1860 der erste Schaukel- Fauteuil aus gebogenem Holz, von dem pro Jahr mehr als 20.000 Stück erzeugt wurden und der in der Gegenwart wieder zu einem beliebten Einrichtungsgegenstand geworden ist. Michael Thonets Möbel wurden fast ausschließlich aus Rotbuchenholz hergestellt. Die Beschaffung des für die Produktion notwendigen Buchenholzes machte es notwendig, die Betriebe in waldreiche Gegenden zu verlegen, wo auch billige ländliche Arbeitskräfte zur Verfügung standen. Dies wurde mit der Fabrik in Koritschan möglich, der bald weitere Gründungen in Bystritz am Hostein 1860, im ungarischen Groß- Ugrocz 1868, in Hallenkau auf der Herrschaft Wsetin 1868, in Radomsk (Russisch- Polen) 1880 und schließlich 1889 in Frankenberg (Hessen) folgten. Als Michael Thonet im Jahre 1871 starb, hinterließ er seinen Söhnen ein Unternehmen, das zu den glänzendsten Vertretern der österreichischen Großindustrie gehörte. Um 1900 beschäftigte die Firma über 6000 Arbeiter, die mit Hilfe von 20 Dampfmaschinen mit zusammen 1100 Pferdekräften täglich 4000 Möbelstücke erzeugten.
Bis zum 1869 garantierte das am 10. Juli 1856 erteilte Privilegium “auf die Anfertigung von Sesseln und Tischfüßen aus gebogenem Holze, dessen Biegung durch Einwirkung von Wasserdämpfen oder siedenden Flüssigkeiten geschieht“ die Alleinerzeugung. Von diesem Zeitpunkt an entstanden dann die ersten Konkurrenzbetriebe, die fast alle von Thonet geschaffenen Möbeltypen in ihre Fabrikation aufnahmen. So erzeugten um 1900 26 Firmen in 35 Fabriken mit rund 25.000 Arbeitern täglich 15.000 verschiedene Möbelstücke, darunter 12.000 Sessel. Von dieser österreichisch- ungarischen Gesamtproduktion der Möbel aus gebogenem Holze wurden ein Drittel im Inland abgesetzt und zwei Drittel ins Ausland exportiert. 1899 wurde der Handelswert der gesamten Jahresproduktion mit 18 Millionen Kronen beziffert und die Ausfuhr betrug 143.228 Meterzentner. Diese Zahlen erfuhren bis zum Ausbruch des ersten Weltkrieges noch eine weitere Steigerung. 1910 waren es bereits 52 Firmen, die in 60 Fabriken mit mehr als 35.000 Arbeitern die Thonet´sche Erfindung verwerteten. Diesen einmaligen Aufschwung eines Industriezweiges verdankte das Thonetsche Mobiliar seiner Materialgerechtigkeit und konstruktiven Wahrheit. Während die kunstgewerbliche Reformbewegung di Orientierung an der Vergangenheit propagierte, folgte Thonet allein der Logik und Sachlichkeit des Materials und der sich daraus ergebenden zweckmäßigen Formen. Als “Wiener Möbel“ haben die Bugholzerzeugnisse ihren Siegeszug um den ganzen Erdkreis angetreten und damit mehr als jedes andere Industrieprodukt nicht nur zum österreichischen “Nationalwohlstand“ beigetragen, sondern auch die Ziele der industriellen Revolution und der kunstgewerblichen Reformbewegung verwirklicht.
Dr. Wilhelm Mrazek
Kustos am Österreichen Museum
für Angewandte Kunst
Vision einer gerechten Produktion
Aus der Zeit der politischen Revolutionen wächst mit Beginn des 19. Jh. das Zeitalter des Fortschrittes, den die Pioniere auf ihre Fahnen geschrieben haben. Gehen diese Träger revolutionärer Ideen auch von verschiedenen, ja oft diametralen Ursprüngen aus, so prägen sich doch dem Jahrhundert ihren Stempel auf: den der Maschine, der Industrie auf der einen Seite, den der sozialen Befreiung auf der anderen. Eine gewaltige Produktionssteigerung, vor allem der Steinkohle und des Roheisens, hat den Pionieren die Möglichkeit gegeben, gerade auf dem Gebiet der Technik weit über das menschliche Maß hinaus zu schaffen. Es erscheint uns kaum erklärbar, dass eine Zeit Männer wie George Stephenson, Joseph Paxton, James Bogardus oder Ludwig Förster oft aus engen Grenzen heraus zu weitgespanntem Wirken komme lässt, zu einer schöpferischen Tatkraft, deren Umfang nur mit der der Menschen der Renaissance vergleichbar erscheint. Es ist der Pioniergeist des Konstrukteurs (und Unternehmers), der die Aufgabentrennung zwischen Architekt und Ingenieur im 19. Jahrhundert bewirkt, den theoretisierenden Bau- “Künstler“ beiseite schiebt und das “Konstruktive“ zu einer Bedeutung erhebt, die bis zum Sieg der Architektur unserer Zeit spürbar bleibt.
Die Zeit der industriellen Revolution brachte, wie jeder Gärungsprozeß, Auswüchse jeder Art mit sich. Unsagbares Elend, gekennzeichnet durch übermenschliche Anforderung an die Arbeitszeit der Industriesklaven, geringe Entlohnung der entwurzelten Menschen, Kinderarbeit und die damit verbundene hohe Sterblichkeit begleitet den Aufstieg der Maschine, der Technik, der Industrie. Es ist fast selbstverständlich, dass in England, dem klassischen Land der industriellen Revolution, sich Männer fanden, die die herrschende soziale Ungerechtigkeit der Maschine zuschrieben. William Morris, auf den Gedanken John Ruskins und der Prä- Raffaeliten aufbauend, suchte das Heil in der mittelalterlichen Werksgemeinschaft, die er als Ideal einer Werkstätigkeit dem vermeintlichen Fluch der Maschine gegenüberstellte. Er wurde zum Vorläufer des englischen Sozialismus auf politischem Gebiet und durch seine Versuche, die mittelalterliche Idee der Werksgerechtigkeit wieder einzuführen, zum Begründer von Erneuerungsbestrebungen, die kaum einige Jahrzehnte später verwandelt und geläutert als Jugendstil zu einer wesentlichen Grundlage in der Geschichte der Architektur unserer Zeit wurde.
In diesen beiden Kräften jener Zeit, gekennzeichnet einerseits durch einen ungestüm bejahenden, über alle Hindernisse hinwegschreitenden Pionier- und Ingenieurgeist, anderseits durch ästhetisierendes, mit sozialem Gedankengut im Hintergrund wirkendes Kunstgewerbe, sehen wir zwei Wurzeln der Architektur unserer Zeit, deren Verbindung oft versucht, aber selten erreicht wurde. Michael Thonet kommt aus dem Handwerk. Die Möbel, sie seine kleine Tischlerwerkstatt um 1830 im Rheinland lieferte, waren allseits beliebt und, nicht zuletzt des angemessenen Preises wegen, sehr begehrt. Der Übergang zur Industrie erfolgte erst, als die Idee des Holzbiegens zur Möbelherstellung technisch in größerem Maßstabe durchführbar wurde. Bei der Arbeit im Palais Liechtenstein in Wien in den Jahren 1843 – 1846 entstehen Sesseltypen, deren Form sich vollkommen aus der technischen Bewältigung der Aufgabe – wenn auch noch rein handwerksmäßig – entwickelt, und die durch Zartheit und Reinehit der Form zu den schönsten Werkes des Möbelbaues zählen, die das 19. Jahrhundert kennt.
Die damals berühmte Firma Carl Leistler, unter deren Namen Thonet für das Palais Liechtenstein arbeitete, hat ebenfalls Stühle hergestellt. Man muß beide Arbeiten nebeneinander sehen, um den Unterschied der Auffassung und der technischen Durchbildung in der vollen Bedeutung erfassen zu können. In den Stühlen für die Londoner Weltausstellung liegt bereits die Form der späteren Industriesessel, besonders aber einzelner Teile (Rückenlehne) zugrunde. Die Dreiecksverbindung zwischen Vorderbeinen und Sitzrahmen stellt eine interessante handwerkliche Lösung dar, die noch in manchen Sesseltypen des Industrieprogrammes (Nr. 13 etwa) anscheinend bis ca. 1875 durchaus gebräuchlich blieb. Aus diesen “Luxusmöbeln“ aus Palisanderholz entstehen nach und nach jene Typen, deren Verkaufserfolg Michael Thonet zur industriellen Herstellung zwang. Hier zeigt sich der gelernte Handwerker wahrlich als Pionier des 19. Jahrhunderts. Michael Thonet entwirft die Baupläne der Fabrik in Koritschan , leitet den Bau und die Einrichtung und schafft – mit seinen Söhnen – die Produktionsgrundlagen. Ein Großteil der notwendigen Maschinen wird selbst entworfen und hergestellt. Die erste Fabrik wird nicht nur in einer Gegend errichtet, die billigere ländliche Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen vermag (fortan werden zur Erzeugung nicht mehr “Professionisten“ verwendet), sondern auch in die Nähe der Rotbuchenwälder, einer Holzart, die für die weitere Erzeugung der Sessel aus gebogenem Holz von entscheidender Bedeutung wurde. Der große Aufschwung geht explosionsartig vor sich – gerade in dem Augenblick, als die letzten technischen Schwierigkeiten durch die Verwendung massiver Stücke gelöst wurde. (Bei Exporten nach Südamerika traten bei Feuchtigkeitseinwirkung Schäden auf, die die weitere Verwendung von Konstruktionsteilen, wie bisher üblich, aus vier oder fünf Furnierdicken, unmöglich machte). Um 1860 also, in der Zeit eines blühenden Historismus, wird mit dem Sessel Nr. 14 eine Form entwickelt, die nicht mehr zu vereinfachen ist. Der “Konsumsessel“ ist geboren.
Die Probleme der Mengenfertigung waren auf einfachste Weise gelöst, Die Sessel konnten, in Einzelteile zerlegt, verschickt werden, die Montage bestand lediglich im Zusammenschrauben der Einzelteile. Die Sessel (Bezeichnung in alten Thonet- Katalogen) waren leicht, haltbar und überall verwendbar und durch Anziehen der Schrauben jederzeit zu reparieren. Sie waren gerade das, was Morris und Van de Velde theoretisch auf Grund ihrer sozialen Einstellung wollten, aber praktisch nie erreicht haben – ein Möbel, das sich jeder kaufen konnte. Betrachten wir jenen Verkaufsprospekt, der ungefähr um das Jahr 1875 entstanden sein muß – ein graphisches Meisterwerk jener Zeit in zartem Graudruck -, sehen wir ein Typenprogramm, das in seiner Konsequenz wohl einen Höhepunkt der Thonetschen Produktion darstellt. Die mündliche Überlieferung sagt, dass August Thonet es war, der in einer Ecke der Fabrik mit wenig Mitarbeitern Form und Konstruktion entwickelte. Eine Form, die bei den gängigsten Typen jene Einfachheit erreichte (denken wir an den Fauteuil Nr. 3, den Schreibfauteuil Nr. 9 oder den Schaukelfauteuil Nr. 1), die sie bis in unsere Zeit brauchbar und formal vollkommen befriedigend erscheinen ließ.
Einer späteren kritisch- vergleichenden Darstellung muß die weitere Erforschung der Entwicklung überlassen bleiben, da es nicht möglich war, in kurzer Zeit jenes Material zu erreichen, das das anonyme Schaffen der “Gebrüder Thonet“ beleuchten könnte. Aus den wenigen zur Verfügung stehenden Katalogen geht aber hervor, dass eine Vereinfachung der Produktion bald jene Typen eliminierte, bei denen einzelne Konstruktionsteile zu sehr dem Handwerklichen nahestanden, etwa die Sessel Nr.6, 9, und 13, deren Verbindung zwischen Vorderbeinen und Sitzrahmen schon erwähnt wurde. Mit der Einführung des Sesseltypes Nr.56 (1885), nach einigen weniger erfolgreichen Versuchen, wird sicherlich einer einfacheren Materialbeschaffung Genüge getan. Die Länge des notwendigen, astfreien Rohmaterials für die rückwärtigen Teile wird auf die Hälfte reduziert.
Der erfolgreiche Sessel Nr.221 verbindet die bequeme Rückenlehne mit Formen, die dem zweiten Rokoko entlehnt sein könnten. Hier allerdings wird jener Punkt erreicht, der eine konstruktiv richtige, aber vielleicht etwas unbequeme Form (die Rückenlehne des Wiener Stuhles “schneidet“ in den Rücken des Sitzenden) den Anforderungen der Bequemlichkeit weichen lässt. Tatsächlich wurden der Sessel Nr.221 und seine Nachfolgertypen zu jenem Sitzmöbel, das dem Wiener Café des Fin du siècle das “Typische“ gab. Die Thonet- Kataloge dieser Zeit bringen Möbel aller Art, Schlafzimmermöbel, Gartenmöbel, Kindermöbel, deren Formen oft in krassem Gegensatz zu der, fast möchte man sagen, klassischen Linie etwa des Typs Nr.14 stehen. In Konstruktion und Form hat auch hier der Eklektizismus eine späten Triumph gefeiert. Neben all diesen Produkten im Makartstil laufen aber jene Typen erfolgreich weiter, in denen der Pioniergeist Michael Thonets spürbar bleibt. Die beiden großen Propheten einer besseren Welt, Adolf Loos und Le Corbusier, verwenden die Thonet- Serienmodelle und erkennen sehr früh die Bedeutung dieses Möbels. Otto Wagners Sessel des Postsparkassenamtes werden in der Fabrik Thonet “gebogen“, und Josef Hoffmann und seine Nachfolger der Wiener Schule versuchen sich unentwegt an den Möglichkeiten des Bugholzmöbels. Das Haus Thonet blieb ihrem Pioniergeist treu. In der Bauhausperiode werden die Stahlrohrmöbel nach Entwürfen von Marcel Breuer, Mart Stam, Mies van der Rohe und Le Corbusier in Thonet´schen Fabriken hergestellt. Giedion nimmt mit Recht an, dass die Entwicklung der Stahlrohrmöbel vom “gebogenen Holz“ beeinflusst sein könnte. Die entscheidende Leistung aber bleibt der “Konsumsessel“. Mit ihm konnte ein wahrhaft “soziales“ Produkt schon im 19. Jahrhundert verwirklicht werden. Man hat die Thonet- Sessel nicht im Salon verwendet, sondern in den Caféhäusern und den Wohnungen der “kleinen“ Leute. William Morris oder Henry van de Velde sprachen vom Sozialismus, aber ihre Auftraggeber waren Könige, Mäzene aus der Aristokratie, Bankleute. Michael Thonet, anfangs von einer verständigen Führungsschicht des alten Österreich gefördert, hat den Sessel für Millionen von Menschen erzeugt. Konstruktive Wahrheit und Materialgerechtigkeit lassen um 1860 bereits ein anonymes Produkt entstehen, das alle Anforderungen des beginnenden Massenkonsums erfüllte. In der Thonet´schen Leistung treten – für die Entwicklung des Möbels gesehen – zwei bedeutende Komponenten des Zeitalters der Industriellen Revolution, der Pioniergeist der Technik und der sozialen Befreiung (durch die Erfüllung des Bedarfes einer neuen Klasse) in eine frühe und so glückliche Verbindung ein, dass wir berechtigt sind, von einem “Stil“ zu sprechen.
Architekt Dipl.- Ing. Karl Mang
Das Biegen des Holzes
(Verlag Bern. Friedr. Voigt, Leipzig, 1922)
Die Unmöglichkeit, Möbel, welche nach der in Rede stehenden vierten Stufe der Entwicklung des “Holzbiegens“ gebildet wurden, der Feuchtigkeit auszusetzen, andererseits aber der Wunsch, das Verfahren möglichst zu vereinfachen, wiesen immer und immer wieder auf das Biegen massiver Holzstücke hin. Thonets bewerkstelligen dies, indem sie die starken Schienen in siedendem Wasser kochten und dann in die Biegformen brachten, welche samt den gebogenen Schienen durch mehrere Tage in Trockenkammern blieben, bis die Feuchtigkeit soweit entfernt war, dass die Biegung die richtige Form beibehielt. Da aber das Holz längere Zeit braucht, um vollständig auszutrocknen, wurden die so gebogenen Teile in Spannvorrichtungen eingeschoben, welche so eingerichtet waren, dass die warme Luft an möglichst viele Stellen des Holzes dringen konnte und so das baldige Austrocknen desselben verursachte. Erst jetzt, nachdem die einzelnen Schienen durch und durch trocken waren, wurden dieselben im erwärmten Zustande mit Leim bestrichen und in die richtige Form gepresst. In diesem Falle also hatte der Leim nur noch verhältnismäßig geringe Spannung auszuhalten. Die bedeutungsvollste Phase in der Geschichte dieser Industrie trat ein. Thonet wandte folgendes Mittel an:
Auf diejenige Fläche des noch ungebogenen, also geraden Stabes, welcher nach dem Biegen die konvexe Seite bilden sollte, wurde ein Streifen aus Eisenblech gelegt und an mehreren Stellen, gewiß aber an beiden Enden durch Schraubenzwingen in unverrückbare, feste Verbindung mit dem Stabe gebracht. Wurde derselbe nun gebogen, so konnte sich der mit dem Blechstreifen verbundene Teil des Holzes nicht mehr strecken, als dieser selbst, also nur um eine verschwindend kleine Größe verlängern. Damit aber eine Biegung überhaupt eintreten könne, musste sich der gesamte Holzkörper stauchen und dies um so mehr, je weiter er vom Blechstreifen entfernt, d. h. je näher er zum konkaven Teil der Oberfläche gelegen war. Das Naturgesetz von der Lage der neutralen Schicht wurde aufgehoben und die neutrale Schicht an die konvexe Oberfläche verlegt. Es gab ferner nicht mehr einen ausgestreckten und einen gestauchten Holzteil; der Blechstreifen in seiner unverrückbaren Verbindung mit dem Stabe zwang das gesamte Holz, sich zusammenzudrücken.
Aus einem Wiener Kabarettprogramm ( “Simpl“ )
vor 1938 (nach mündlicher Überlieferung).
Einladung bei Löbel´s:
“Und der Hausherr zeigt voll Stolz Thonet´s
Möbel aus gebogenem Holz!“ Später erscheint der
Sohn des Hauses, dessen “O-Beine“ nicht zu
Übersehen sind. Der Gast beruhigt den Hausherrn
(auf “wienerisch“) “Machen´s sich nichts draus,
Herr Löbel, passt das Kind halt zu die Möbel.“
Wilhelm Franz Exner
“Die neue Baugesinnung“
Handwerk und Industrie von heute sind in ständiger Annäherung begriffen und müssen allmählich ineinander aufgehen zu einer neuen Werkeinheit, die jedem Individuum den Sinn der Mitarbeit am Ganzen und damit den spontanen Willen zu ihr wiedergibt. Das ist bedingungslose Voraussetzung für gemeinschaftliche Aufbauarbeit. Das Handwerk der Zukunft wird in dieser Werkeinheit das Versuchsfeld für die industrielle Produktion bedeuten; eine spekulative Versuchsarbeit wird die Normen schaffen für die praktische Durchführung, für die Produktion in der Industrie. Der Handwerk- Treibende muß dies wissen, damit er nicht in Eigenbrötelei verfällt ...
Für jeden aber, der gestalten und bauen will, ist die handwerkliche Vorbildung unentbehrlich, sie stärkt nicht nur seine räumliche Vorstellungskraft, sondern stellt auch eine unbewusste Beziehung seines Wesens mit den Stoffen und den Gesetzen der Natur her, sie verwurzelt sein ganzes Schaffen im Elementaren; die Technik wird ihm nun ihrem Wesen nach vertraut, und er verliert sich nicht in Theorie und Rechnung.
Walter Gropius
Poul Henningsen über den “Wiener Stuhl“
(in “Kritisk Revy, 1927)
“Wenn ein Architekt diesen Stuhl fünf mal so teuer,
drei mal so schwer, halb so bequem und ein viertel
mal so schön herstellt, kann er sich wirklich einen
Namen machen.“
- Auszug aus 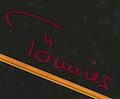 ANTIQUITÄTEN ALMANACH 1989/90 -
ANTIQUITÄTEN ALMANACH 1989/90 -
Englische Möbel
Eigentlich sind sie zu beneiden, unsere Insularen Nachbarn. Vor Jahrmillionen wurde die englische Insel samt kleineren Anhängseln vom Kontinent abgesprengt. Seitdem können die Briten ein recht beschauliches Leben führen, so gut wie unangefochten von den Wirren, Kriegen, Katastrophen, die Kontinentaleuropa seit Christi Geburt immer wieder heimgesucht haben. Gewiß musste Cäsar mal sehen, wie vor ihm schon die Kelten und Phönizier, was es auf der Insel Entdeckenswertes gibt. Gewiß setzten Wikinger, Angeln, Sachsen, Jüten und Normannen über das mehr oder minder weite Meer, welches England vom Kontinent trennt. Einige zogen wieder nach Hause, andere blieben und verschmolzen dank der isolierten Lage dieses Landes – zugegebenermaßen nach einigem Hin und Her – auf wundersame Weise zu einer Nation. Seither ist England mit den Begehrlichkeiten seiner Nachbarn gut zurechtgekommen. Mit “stiff upper lip“ und kühler Distanz betrachteten sie, wie den Nationen auf dem Festland immer neue Möglichkeiten einfielen, sich gegenseitig zu zerfleischen. Die Engländer dagegen leisteten sich nur den 100jährigen Krieg mit Frankreich, den Krieg der Rosen (eine dynastische Auseinandersetzung) und einen mittleren Bürgerkrieg. Ansonsten lebten sie britisch und erfanden den Begriff der “splendid isolation“.
Engländer haben im allgemeinen einen gänzlich anderes Verhältnis zu Antiquitäten als wir. Es sind Gegenstände des täglichen Gebrauchs, integriert und benutzt in allen Wohnbereichen. Früher – zu Zeiten des British Empire – wurden die Gegenstände von zahlreichem Personal gepflegt. Was man immer wieder an der wunderbar erhaltenen Patina englischer Antiquitäten ablesen kann. Heute gibt es kaum noch dienstbare Geister, und die Möbel werden halt auch nicht mehr regelmäßig poliert. Stört das den Briten? Nein! Ich habe bei Freunden in London eine zierliche, recht wertvolle, “Mid Georgian“- Nussbaumkommode im Kinderzimmer gesehen. Ich kenne einen Rechtsanwalt, in dessen Büro ein sehr seltener Architekten (Zeichen)Tisch des späten 18.Jh. steht, und darauf – arbeitet ein Computer. Und wenn dem Eigentümer eines antiken Stückes im Laufe der Zeit das ererbte Teil nicht mehr gefiel, weil unpraktisch oder unmodisch, so wurde es kurzentschlossen umgebaut, in aller Unschuld, nicht mit der Absicht zu verfälschen. Auch einzelne, nicht zusammengehörige Stücke wie z. B. eine Kommode von der Großmutter mütterlicherseits und ein einsamer Aufsatz vom Großvater väterlicherseits erden unbekümmert zusammengesetzt. Der Schreiner legt noch ein wenig Hand an, um allzu große zeitliche Unterschiede auszugleichen – und schon ist der begehrte Aufsatzsekretär fertig. Es entsteht eine “Hochzeit“. Für den deutschen Sammler erschreckend, aber so typisch englisch, ist im vergangenen Jahrhundert die Freizeitkunst des Schnitzens. Es entstand eine wahre Mode. Alte Eichenstücke wurden “liebevoll“, und vor allen Dingen üppig, überzogen mit Schnitzarbeiten. Auch mancher englischer Restaurator ging sorglos mit den alten Schätzen um. Manchmal gewinnt man den Eindruck, der Schreiner habe gerade Urlaub gehabt und an seiner Stelle sei der Dorfschmied eingesprungen. Warum nicht schön fest nageln oder schrauben? Wenn nötig, den fragilen Regency- Stuhl mit Eisenbändern verstärken? Deutsche Restauratoren sollen schon erblasst sein bei der näheren Betrachtung einer englischen Antiquität, die der stolz strahlende Besitzer von seinem letzten Englandurlaub mitgebracht hat.
Im Gegensatz zu Deutschland ordnet England seine überkommenen Wertgegenstände nicht nach kunsthistorischen Epochen ein. Vielmehr werden sie nach Dynastien, politischen Ereignissen oder Herrschern benannt. Und daran halten die Briten auch fest. Wenn Sie in einem englischen Auktionskatalog blättern, so werden Sie bemerken, dass kontinentale Antiquitäten fein säuberlich mit den jeweils landesüblichen Bezeichnungen wie Rokoko (deutsch), Louis Quinze (französisch), usw. beschrieben sind, während englische Möbel mit den englischen Zuordnungen versehen sind, wie z. B. Mid- Georgian. Sie brauchen also einige Geschichtskenntnisse, um ihr Lieblingsstück datieren zu können und ein recht solides Stilempfinden. Denn zu den Herrschernamen als kunstgeschichtliche Begriffe treten bei englischen Objekten des mittleren 18.Jh. auch noch die Namen berühmter Möbelentwerfer wie Chippendale, Adam, Hepplewhite, Sheraton.
Nicht genug damit! Die Briten verhielten sich bei der Rezeption “modischer“ Impulse recht zögernd – die Entwicklung neuer Stile ging in den vergangenen Jahrhunderten immer vom Kontinent aus, zunächst von Italien, dann Frankreich. Trotz immer wieder eng gewobener, verwandtschaftlicher Beziehungen, vor allen Dingen zum französischen Hof, adoptierten die insularen Verwandten die neuen Stilelemente mit Zurückhaltung und verwandelten sie stets etwas “typisch“ Englisches. Zum Beispiel: Renaissance. In England heißt sie Early Tudor, Elizabethan, Jacobean, Commonwealth –in dieser Reihenfolge. Unter dem ersten Tudor- König Heinrich VII, mit dessen Inthronisation der Rosenkrieg endlich beendet ist, baut England weiter unverdrossen in gotischem Stil, bringt besonders auf dem Gebiet der Architektur Großes hervor. Sein Nachfolger, der berühmt- berüchtigte Heinrich VIII, wird zum ersten wirklichen Kunstmäzen. Er holt berühmte Künstler an seinen Hof (Hans Holbein, Augsburg) und öffnet die Insel für das revolutionierende Gedanken- und Formengut der Renaissance. Er lässt Möbel aus Europa einführen, deren Vielfalt und Pracht seine Untertanen inspirieren sollen. Nach einigen Wirren folgt ihm seine Tochter Elizabeth, “die jungfräuliche Königin“, auf dem Thron.
In der Regierungszeit dieser beiden Monarchen erlebt das englische Kunsthandwerk einige Neuerungen. Bei uns am bekanntesten dürfte wohl die Entstehung der “Non- Such“- Truhe und des “Mule- Chest“ sein, beides Kastenmöbel. Das erstere zeigt auf der Front virtuose Einlegearbeiten und eine architektonische Gliederung, wahrscheinlich unter norddeutschem Einfluß entworfen. Das “Mule- Chest“ ist ein Zwittermöbel und hat wegen dieser Eigenschaft seinen Namen (mule, engl.= Maulesel): Der untere Teil birgt Schubladen, der obere Teil ist ein Truhenteil, später mit Fronttüren. Im ganzen wird die Einrichtung einfallsreicher, dekorativer, in der Technik komplizierter. Nicht der Zimmermann und Tischler sind mehr gefragt, sondern der Kunstmöbel- Tischler. Er verarbeitet weiter hartnäckig Eiche. Als der einheimische Vorrat nicht mehr reicht, importiert man aus dem Baltikum. Es darf auch schon mal Rüster (Ulme) sein. Während ab 1600 in Frankreich und Deutschland der warme Ton des Nussbaumholzes die vorherrschenden Eiche und Esche immer häufiger verdrängt. Nach Elizabeth´s Tod hält zwar der Renaissance- Stil in England noch an, doch die Ereignisse überschlagen sich.
Mit der Thronbesteigung von James I. Stuart (1603) wird das Königshaus wieder römisch- katholisch. Die Neue Welt war ja schon erobert. Nun wandern ab 1620 die protestantischen Puritaner nach Amerika aus, neue Hölzer werden bekannt. Gleichzeitig erreichen England starke Impulse durch die Kolonisierung des asiatischen Erdteils. Jakobs Sohn, König Karl I., vereinigt in sich hohen Kunstverstand und absolutistische Neigungen.
Aber das ist in Europa ja auch nicht anders! Er sponsort Rubens und bestellt van Dyck zum Hofmaler. Das Barock kann seinen Einzug auf der Insel halten. A propos Barock: in England heißt es: Restauration, William and Mary, Queen Anne, Konturen geraten in Bewegung, der König richtet seine Schlösser mit punktvollen, virtuos gearbeiteten Möbelstücken ein. Doch die Freude ist von kurzer Dauer. 1649 demonstrieren die Engländer ihren Nachbarn auf dem Festland, dass auch ein regierender Monarch hingerichtet werden kann. Der Lordprotector Oliver Cromwell – protestantisch, herb und sittenstreng – ruft die Republik aus. England erstarrt in elfjährigem, puritanischem Schlaf, zumindest was Kreativität und Erfindungsreichtum im Kunstgewerbe betrifft. Die Thronbesteigung Königs Karl II. 1660 und der große Brand von London (1666) sorgen für einen Bedarf an Innovation bisher ungekannten Ausmaßes. Der Geschmack des Herrschers ist in seinem französischen und holländischen Exil geprägt worden. Mit ihm kommen moderne Handwerker, zu gleichen Zeit fliehen Hugenotten, traditionell künstlerisch hervorragende Meister, aus Frankreich über den Ärmelkanal. Großbritanniens Kunsthandwerk entfaltet eine ungeahnte Blüte, die Fertigkeiten der Furnierarbeit, der Intarsien und Marketerien, des Vergoldens und der Chinoiserie entwickeln sich allenthalben. Dies ist wohl die einzige Periode, in der englische von holländischen und norddeutschen Produkten manchmal schwer zu unterscheiden sind. Eichenholz hat ausgedient, das “Age of Walnut“ bricht an. Neben Südengland sind Frankreich und Amerika die Hauptlieferanten des begehrten Materials. Geschmückt wird es mit verschiedenen Obsthölzern, Oliven- und Goldregenholz. Dies ist auch die Zeit, in der neue Möbeltypen entstehen. Die uns heute liebgewordene Wandelbarkeit und vielseitige Verwendbarkeit der englischen Antiquitäten hat hier ihren Ursprung. Genannt seien: “Monks Bench“ und “Gateleg- Table“, “Side- Table“, “Highboy” und ”China- Cupboard”. Im adligen Arbeitszimmer stehen Bücherschränke. In der Zwischenzeit hat 1685 ein neuer König den Thron bestiegen, Jakob II. Er macht Probleme, das er zum Katholizismus übergetreten ist. Er muß fliehen, der Schwiegersohn, Wilhelm III. von Oranien, regiert gemeinsam mit seiner Gattin Mary. Der Niederländer ermutigt holländische Meister, nach England zu kommen. Die Weltmachstellung der beiden nun dynastisch verbundenen Nationen ermöglicht einen starken Zustrom asiatischer Arbeiten und Techniken nach Europa.
Der mächtige Aufschwung des Kunsthandwerks bahnt neuen Möbeltypen den Weg: Kommode, Schrägklappensekretär, “Large Bureau“, “Bureau Bookcase“, “Bachelor´s Chest“, “Day Bed“. Geschwind ein Wechsel auf dem Thron, ab 1702 regiert Queen Anne, Schwägerin Wilhelms von Oranien. Das “Cabriole Leg“, ein S-förmig geschwungenes Möbelbein auf Bocks- oder Kissenfüßen, wird entworfen und greift auf alle Einrichtungsgegenstände über. Seither wird es immer wieder von britischen Handwerkern verarbeitet, es ist nicht fortzudenken aus dem Bereich “Englische Antiquitäten“. Übrigens als Begriff auch nicht übersetzbar. Der Einrichtungsstil kann fast gemütlich genannt werden. Denn der englische König dieser Zeit ist kein absolutistischer Herrscher. Sein Adel ist auf viele, weit auseinandergelegene Schlösser und Landsitze verteilt. Und die britischen Monarchen sind seit Elizabeth I. eigentlich fast alle recht reisefreudig. Natürlich nur auf der Insel! Während die europäischen Länder nach 1700 – mit Ausnahme Frankreichs – dem Barock in seinem bewegten Formenreichtum frönen, bleiben die englischen Möbel praktisch, zurückhaltend dekoriert, von außerordentlicher stilistischer und handwerklicher Harmonie. Die uns heute bekannte Vielzahl von Tischen und Beistellmöbeln hat ihren Ursprung in dieser Zeit. Fast alle sind klappbar (turn- over- top- Mechanismus), ausziehbar, verkleinerbar. Eine unnachahmliche Variante auf dem Antiquitätensektor.
Als Queen Anne 1714 stirbt, hinterlässt sie eine Lücke- und Ratlosigkeit. Es gibt keine regierungsfähigen Stuarts mehr. Fragend prüft das Parlament den Stammbaum, die Wahl fällt auf einen Urenkel König Jakobs I., den Hannoveraner Kurfürsten Georg Ludwig, als George I. englischer König. Unter seiner Regierungszeit und der seiner Nachfolger geht die Entwicklung englischer Möbel ganz eigene Wege. Benannt werden sie nun Early Georgian (1714-1727), Mid Georgian (1727-1760), Late Georgian (1760-1820), Regency (1820-1830), William IV. (1830-1837). Bei uns heißen diese kunsthistorischen Epochen Hoch- und Spätbarock, Rokoko, Zopfstil, Empire, Biedermeier. Eine wesentliche Neuerung dieser Zeit ist der stürmische Vormarsch des Mahagoni- Holzes ab 1720, importiert aus Puerto Rico und Santo Domingo, ab 1750/60 aus Kuba. Das seit Ende des 18. Jahrhunderts aus Jamaica und Honduras eingeführte Mahagoni ist in seiner Beschaffenheit leichter und nicht so hochwertig. Es ist notwendig, die verschiedenen Provenienzen des Mahagoni zu erwähnen, denn seine unterschiedliche Färbung, Maserung und Güte sind bei der Beurteilung von Möbeln des 18. Jahrhunderts ein wichtiges Kriterium. In dieser Zeit werden der meist vier- etagige “Dumb Waiter“ entwickelt und der “Tripod-Table“. Überhaupt Tische: Schreibtisch, Zeichentisch, Lesetisch, Nähtisch, Spieltisch, Waschtisch, Nachttisch, Pembroke-Table, Sutherland-Table (19.Jh.), Tea-Table, Breakfast-Table, Sofa-Table, Rent-Table, Library-Table, D-End-Table, Pier-Table, Low-Boy. Kurz, Tische aller Art. Die englische Antiquitätenwelt ist ohne diese außerordentliche Vielfalt an Tischen nicht vorstellbar. Das gleiche gilt für Stühle. Denn dies ist auch die Zeit der großen Möbelentwerfer und Kunsttischler (s.o.). Sie alle entwerfen auch Stühle. William Kent kreiert den Ball- und Klauenfuß, der begeistert aufgenommen wird. Das Beinknie ist reich geschnitzt mit Satyrkopf, Muschel, Akanthus. Thomas Clippendale nimmt die Impulse des Rokoko auf höchst englische Weise auf. Zwar verarbeitet er C- und S-Schwünge, doch vereint er sie auf dem Höhepunkt seines Schaffens mit chinesischen und gotisierenden Elementen. Sein unverwechselbarer Stil entsteht. Neben Rosenholz verwendet er mit Vorliebe massives Mahagoni. Seine Schränke haben einen geschnitzten Fries und Schwanenhalsgiebel. Seine Stuhllehnen sind in Stab- und Gitterwerk verschlungen. Gegen Ende seiner Wirkungszeit leitet er selbst behutsam zum Klassizismus über, der von Adam und Hepplewhite zur Perfektion entwickelt wird. Möbel von unnachahmlicher Schönheit entstehen, von unübertroffener Stilsicherheit, Eleganz und Harmonie. Satinholz und Palisander bedrängen das Mahagoniholz in seiner Favoritenrolle. Der Nachfahre der ganz großen, englischen Möbel-Designer ist Thomas Sheraton. Sein strenger, klarer Stil reicht bis ins Regency hinein.
Das Regency (1820 – 1830) bringt – wie die vorangegangenen Strömungen – eine Vielzahl an Stuhlentwürfen hervor. Diese Stühle sind sehr grazil, haben Säbelbeine, eine rechteckige, nach hinten geneigte Lehne. Die bekannteste Sitzgelegenheit der Zeit ist der „Trafalger-Chair“, benannt nach Nelsons Sieg in der Schlacht von Trafalger im Jahre 1805. Regency-Stühle sind heute außerordentlich gefragt und erreichen – vor allen Dingen als ganzer Satz – schwindelerregende Preise. Aus der gleichen Zeit stammen “Quartettos“, ineinanderstellbare Beistelltischchen, und der “Teaboy“, ein vergrößerter Teebehälter mit Fußgestell. Wenn man davon absieht, dass ein König entmündigt werden muß (George III.) und statt seiner George IV. Regent ist (daher die Bezeichnung Regency), hat England eine Zeit dynastischer Ruhe hinter sich. Mit den Hannoveranern hatte man also, alles in allem, einen recht guten Griff getan. Der jugendliche, korsische Kaiser auf dem französischen Thron stört vorübergehend die Beschaulichkeit der Briten. Aber schließlich muß der ja nach St. Helena. In Europa brodelt es unterschwellig, in England bereitet sich in rasanten Schritten die industrielle Revolution vor. Da stehen die Briten 1837 schon wieder von einem Problem. Wer soll König werden? Die Frauen des Hauses Hannover dürfen nicht regieren. Man schaut sich um und findet – Victoria. Der jungen Königin ist eine gesegnet lange Regierungszeit beschert. Doch auch sie mag oder kann nicht so ganz ohne Deutsche auskommen. Sie wählt ihren Cousin Albert aus dem Hause Sachsen- Coburg- Gotha zum Prinzgemahl. Das Kunstgewerbe, das während ihrer langen Regentschaft (1837 – 1901) entsteht, hat die Bezeichnung Victorian.
Eigentlich recht einfach. Bei uns fallen unter dem Sammelbegriff Historismus an: zweite Gotik, zweites Rokoko, zweites Barock, zweite Renaissance, zweites Empire, drittes Rokoko. Natürlich haben die historistischen Stilelemente auch Einfluß auf die victorianischen Möbel. Ist es doch Victorias Gatte Prinz Albert, der im Jahre 1851 in London die erste Weltausstellung ermöglicht. Dort fließen alle oben erwähnten Strömungen zusammen oder zeichnen sich ab. Man denke an “Gothic Revival“, dessen Wurzeln im England des 18.Jh. liegen. Dafür benötigt man wieder Eiche und auf Ebenholz gebeizte Buche. Palisander und Mahagoni bleiben neben dem wiederentdeckten Nußbaumholz tonangebend. Zu diesen Werkstoffen tritt als neues Material Papiermaché, das schwarz lackiert und mit Perlmutt/Metalleinlagen und floraler Malerei dekoriert wird. Eine gänzlich eigene Schöpfung der victorianischen Zeit ist der “Balloon-Back-Chair“, dessen ovale, offene Rückenlehne etwa vierzig Jahre lang in Mode ist. Der seit Beginn des Jahrhunderts beliebte “What-Not“ besteht unvermindert fort ebenso wie der “Davenport“, ein neuer Schreibtischtyp. Er besteht aus einem Schubladenkasten mit Pult, dessen Schrägklappe als Schreibunterlage dient, die Schubladen öffnet man an den Seiten.
In den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts protestiert William Morris mit einigen Zeitgenossen gegen Massenproduktion, Stilunreinheiten und Schwulst. Er gründet “Arts and Crafts“. Gegen Ende der Regierungszeit Königin Victorias bricht sich der Jugendstil Bahn, in England Art Nouveau genannt. Beardsley, Mackintosh und Oscar Wilde sind seine berühmtesten, britischen Repräsentanten. Neben der Art Nouveau ein bei uns oft verkannter, außergewöhnlich gefälliger Stil, Edwardian, benannt nach dem 1901 gekrönten König Edward. Es handelt sich dabei um Nachbildungen alter Möbel aus der Hoch-Zeit englischen Kunstmöbelhandwerks von solider Qualität. Klassische Strenge ist eines ihrer wichtigen Merkmale, Faden- und Sterndekor. Es ist manchmal recht schwierig, einem deutschen Kunden die Hochwertigkeit dieser Antiquitäten einleuchtend zu machen. Denn bei uns rangiert ganz gern Purismus vor Sympathie. Der Befund ist eindeutig: Edwardian-Möbel sind beabsichtigte Nachbauten, haben niemals den Charakter von Fälschungen. Sie sind unprätentiös, zierlich, elegant.
Bis vor 10 Jahren war England das Dorado für Kunstliebhaber. Noch heute kann man die Versteigerung eines kompletten Schlossinventars in großen Antiquitätenzeitschriften annonciert finden. Noch heute befinden sich Gold- und Silberbörse, Edelstein-, Schmuck- und Teppichbörse in London. Die großen Auktionshäuser haben eine jahrhundertealte Tradition. Sie bilden das Zentrum des internationalen Kunsthandels. Hier werden Preisentwicklung und Trends “gemacht“, die mit einiger Verzögerung Deutschland erreichen. Besuchen Sie in London eine Versteigerung. Sie können entdecken, was bei uns in ein bis zwei Jahren die Preise machen wird. And keep smiling, in this Genre, Great Britain deserves it.
- Auszug aus 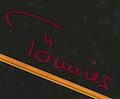 ANTIQUITÄTEN ALMANACH 1989/90 -
ANTIQUITÄTEN ALMANACH 1989/90 -
Historische Möbelkultur auf dem Lande
Nicht nur das Haus, auch das Möbel zählt zu den langlebigen Kulturgütern. Truhen und Schränke sind in Niedersachsen aus dem 11. bis 16. Jahrhundert in Kirchen, Klöstern und Rathäusern, in Bürger- und Bauernhäusern und seit dem späten 19.Jh. auch in Museen noch in einigen hundert Exemplaren überliefert; aus dem Zeitraum von 1600 bis 1800 ergeben dieselben Möbeltypen in privatem und öffentlichem Besitz allein in Niedersachsen selbst bei vorsichtiger Schätzung immerhin noch einen Bestand von weit über 30.000 Objekten. Mit Hilfe dieser materiellen Kulturgüter gelingt es vor allem dann, wenn sie in repräsentativen Mengen dokumentiert, durch Schriftzeugnisse aller Art quantitativ hinterfragt und in “kombinierter Quellenanalyse“ ausgedeutet werden, in wirkungsvoller Weise, die von außen in die jeweiligen Regionen einwirkenden mächtigen Innovationsschübe, die exogenen Kulturströme, zu analysieren, aber ebenso die innerhalb der jeweiligen Region sich entwickelnden endogenen Kulturabläufe zu registrieren. Für die Forschungsrichtung “Systematische Möbeldokumentation“ konnten zwischenzeitlich in vier Kulturregionen des Weser- Ems- Gebietes auf fotodokumentarischem Wege repräsentative Möbelquantitäten erfasst und analysiert werden
1.) im Altlandkreis Bersenbrück, speziell im Osnabrücker Artland,
2.) im Oldenburger Münsterland,
3.) auf dem Hümmling,
4.) im Oldenburger Ammerland. An die 8000 Möbel wurden in diesen Regionen katalogisiert und in verschiedenen Publikationen ausgedeutet. Allein schon die Interpretation einer solchen Menge von erfassten historischen Möbeln, also allein die Objektanalyse, vermittelt neue Perspektiven zur Periodisierung der Sachkultur, zur Entwicklung des kulturellen Eigengepräges der Region und zur Analyse komplexer Bedingtheiten gesamtkultureller Phänomene. Die Grenze der Interpretation kultureller Äußerungen sozialer Gruppen durch die Sachkultur allein ist allerdings alsbald erreicht, wenn nicht nur nach den Wirkungen, sondern auch nach den Ursachen dieser Phänomene geforscht wird. Die Sachkulturforschung setzt anschauliche Signale, die der in erster Linie nur anhand von Archivalien forschende Historiker nicht empfangen kann: diese Kulturphänomene aber müssen entschlüsselt werden durch die Erstellung des Zeitkontextes, durch das Erforschen politischer, wirtschaftlicher, konfessioneller und sozialer, also insgesamt historischer Zeiterscheinungen. Aus diesem Grunde bemüht sich das Niedersächsische Freilichtmuseum Cloppenburg seit Jahren erfolgreich um interdisziplinäre Kooperation mit Historikern benachbarter Universitäten, vor allem mit denen, die sich auf den Gebieten der Regional-, Wirtschafts- und Bevölkerungsgeschichte engagieren.
Auf zwei Forschungsergebnisse, die für das Verständnis des Phänomens regionaler Kulturentfaltung von grundlegender Bedeutung sind, sei in aller Kürze aufmerksam gemacht:
1.) Fast ein Jahrhundert früher als im aufwendigen Hausbau ist die Ausformung regionaler, oftmals auf ein oder zwei Kirchspiele eng regional- begrenzter Formen- und Dekorelemente, also Kulturausprägungen am historischen Möbel, ablesbar. In prosperierenden ländlichen Regionen, wie dem Artland und dem Ammerland, hat sich in der Zeit um 1600, jedoch nicht früher, in weniger bevorteilten Landstrichen wie dem Hümmling und dem Oldenburger Münsterland dagegen erst gut ein Jahrhundert später, eine regionalgeprägte, eigenständige Möbelkultur im ländlichen Raum herausgebildet, ein im zeitlichen Ablauf bislang verkanntes Kulturphänomen.
Bei der Suche nach den Ursachen zäsurartiger Kulturumschwünge muß beachtet werden, dass für diese komplexen Vorgänge monokausale Erklärungen niemals ausreichen; vielmehr muß ein umfängliches, in der jeweiligen Region unterschiedlich wirksames Ursachenbündel für eine fundierte Analyse ausfindig gemacht werden. Andeutungsweise sei auf einige Faktoren aufmerksam gemacht:
a) Im Zuge der Auseinandersetzungen zwischen Reformation und Gegenreformation kommt es kurz nach 1600 zwischen dem Artland und dem Niederstift Münster oder dem Ammerland und dem Niederstift Münster zu immer stärker werdenden Heiratsgrenzen, zu Heiratsbarrieren.
b) Die Anzahl der holzverarbeitenden Handwerker, also der potentiellen Möbelproduzenten, steigt im ländlichen Raum gegen Ende des 16.Jh. merklich an.
c) Besäße die ländliche Bevölkerung nicht eine entsprechende Kaufkraft, gäbe es für das Handwerk keinen Markt, keinen Anlaß, auf dem “platten Land“ zu arbeiten. Ohne handfeste Ergebnisse, wie z. B. auf den Gebieten der Konfessions-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, lassen sich die vernehmbaren Signale der Sachkulturforschung also nicht sinnvoll entschlüsseln; umgekehrt ist aber auch zu formulieren, dass bei einem Ausblenden der Analyse der überlieferten materiellen Kultur bestimmte Signale aus der Geschichte nicht mehr empfangen werden können. Angesichts dieses “Sachverhalts“ spricht alles für einen komplexen Zugriff, für eine allseitige Quelleninterpretation und entsprechend für eine fächerübergreifende und interinstitutionelle Zusammenarbeit auf dem Gebiet historischer Forschung; darum bemüht sich als gebender und zugleich als nehmender Partner auch das Niedersächsische Freilichtmuseum Cloppenburg.
2.) Für viele Gebiete Niedersachsens gilt die Mitte des 19.Jh. als die Zeitmarke für das Ende der regional geprägten Sachkultur. Für das Oldenburger Ammerland und für das Osnabrücker Artland ist aber nachweisbar, dass dieser Umbruch schon um 1810 erfolgt. Mit einer Verspätung von gut einer ganzen Generation tritt diese Zäsur dann auch im Oldenburger Münsterland und im Hümmling ein. Die Ammerländer und Artländer Möbelproduzenten finden für Kastentruhen mit Kufengestell, für kombinierte Kleider- Wirtschaftsschränke, für Brotschränke, für offene Anrichten, für eisenbeschlagene Koffer etc. keine Käufer mehr. Das über Jahrhunderte gefragte, fast unvergängliche Eichenholz ist im Möbelbau nach dieser Zeit nicht mehr attraktiv. Das Ende einer regional ausgerichteten, einer “altartig- traditionellen“ Sachkultur ist endgültig erreicht. Diese Wende in der Möbelkultur, auch in einem Möblierungsmuster fassbar, kommt einer Zäsur gleich, wie sie für dieselben Regionen um 1600 festgestellt werden konnte. Diese wichtige Wende am Übergang vom Empire zum Biedermeier, vom Ancien Régime zur neuen bürgerlichen Gesellschaft ist ebenso multikausal bedingt wie der Zeitabschnitt der Entstehung regional geprägter Kultur: Gegen Ende des 18.Jh. wurde auch im ländlichen Raum Niedersachsens die Hektik der einander in kürzeren Zeitabständen ablösenden Zeittrends spürbar.
Das zu dieser Zeit immer stärker ausgeprägte und tief in den ländlichen Raum eindringende Verlagswesen veränderte den traditionellen Novationsverlauf kultureller Impulse. Über die neuen Medien Buch und Zeitung, Verlagskatalog und Prospekt war der Produzent und auch der Konsument auf dem Lande ohne größere Zeitverzögerung direkt erreichbar. Dieser Prozeß wurde außerordentlich beschleunigt durch das im 19.Jh. stark verbesserte Wege-, Straßen- und Postsystem sowie das in der 2.Hälfte des 19.Jh. voll funktionsfähige Eisenbahnnetz. Die Alphabetisierung breitester Bevölkerungsschichten im nordwestlichen Niedersachsen – ca. 80% aller Bevölkerungsschichten konnte schon im 18.Jh. lesen und schreiben – und die im Zuge der Aufklärung intensiv einsetzende Literarisierung ländlicher Ober- und Mittelschichten bewirkte ein übriges.
Schon im frühen 19.Jh. waren auch die ländlichen Bevölkerungskreise bereit, das in der Ferne produzierte oder nach dem Trend weit entfernt liegender Produktions- oder Designzentren entworfene Kulturgut- wie Mobiliar, aber auch Kleidung – in die eigene Wohnung aufzunehmen, sich damit zu umgeben und das bis dato nach “uralter“ Tradition gepflegte Ausstattungsmuster gewissermaßen in kürzester Zeit über Bord zu werfen. Das “traditionell-altartige“, das kleinregional geprägte Kulturgut aus der Epoche des Ancien Régimes wird zugunsten einer überregional gültigen “zeitgemäßen“, nicht schichtgebundenen Sachkultur der Post- Ancien- Régime- Zeit ausgewechselt. Wie kaum eine voraufgegangene politisch- geistige Umwälzung der Neuzeit – abgesehen von der Reformation und Gegenreformation – haben gerade die Aufklärung sowie die Französische Revolution, vor allem die neue durch die Franzosen vermittelte Freiheitsidee, alle Gemüter in Stadt und Land zutiefst bewegt.
Für viele Museen bedeutet das Auslaufen der “traditionellen“ Möbelformen und Wohnmuster zwischen 1800 und 1850 das Ende ihrer Sammlungsbemühungen. Da bereits das Biedermeiermöbel großregional an weit verbreiteten Verlagskatalogen und Möbeljournalen orientiert war, betrachtete man es als scheinbar austauschbar und entregionalisiert. Noch konzeptionsloser verharrte das Museumwesen bis heute – von wenigen rühmlichen Ausnahmen abgesehen – in der Sammel- und Dokumentationspraxis bei Möbeln aus der Zeit des Historismus (von 1870 bis 1910).
Aufgrund der vom Niedersächsischen Freilichtmuseum Cloppenburg in großer Zahl entdeckten und in zahlreichen Publikationen ausgewerteten Werkstattanschreibebücher, sowie Archive ländlicher Handwerker, ist mit Nachdruck darauf zu verweisen, dass trotz des fast abrupten Umsteigens auf neue Möbelstile und Möbelproduktionsweisen auch im ländlichen Raum ab 1800 die bestehenden Werkstätten nicht nur weiter produzierten, sondern die Möbelherstellung entsprechend den neuen Wohnwünschen sogar erheblich steigerten. Die Mengen der auch in ländlichen Werkstätten produzierten und von ländlichen Käuferschichten angeschafften Möbel nehmen im Zeitraum von 1800 bis 1900 ständig zu. Daher bedarf das Museum auch eines neuen sinnvollen Sammel- und Forschungskonzeptes für das Historismusmöbel und für das Wohnen mit diesem Mobiliar im 19.Jh.
Ein einfaches Rezept dafür lautet: Diese Möbel sind wieder mit dem notwendigen Zeitkontext zu umgeben und erneut zu “regionalisieren“. Es gilt der Frage nachzugehen, welche Werkstatt in der Region diese Vorlagemöbel mit welchen Handwerksmethoden und unter welchen Existenzbedingungen sowie bei welchem Preis- und Zeitaufwand für wen produziert hat usw., also den überaus vielfältigen Fragenkomplex der Möbelproduktion in der Region oder für die Region aufzugreifen. “Regionalisierbar“ ist das historische Möbel dieser Epoche auch aus der Sicht der Möbelkonsumenten, in dem nach deren Wohnmuster und deren Umbaumaßnahmen in den Wohn- und Wirtschaftsräumen usw. gefragt wird.
Das Möbel und die Möblierung der Räume in der Biedermeier- und Gründerzeit (1815 bis 1910) des ländlichen Niedersachsens wurden als Thema eines neuen Schwerpunktprogramms für das Niedersächsische Freilichtmuseum Cloppenburg ausgewählt, um mit einem erfolgversprechenden Forschungskonzept das Ziel zu verfolgen, eine regionale Sozialgeschichte des Wohnens oder, allgemeiner formuliert, eine regionale Kultur- und Sozialgeschichte gerade auch des 19.Jh. in Schrift und Ausstellung dokumentieren zu können.
Historische Wohnkultur auf dem Lande
Seit mehr als einem Jahrzehnt, seit der Neuorientierung der Volkskunde als einer Disziplin der historischen Kultur- und Sozialwissenschaft, ist erfreulicherweise auch die volkskundliche Hausforschung erfolgreich bemüht, über die bloße Bau- und Raumstrukturanalyse der Gebäude hinausgehend, differenzierte Ergebnisse zur Funktion der Räume, zur Lebens-, Wohn- und Wirtschaftsweise des Menschen in den Häusern, zur Sozialgeschichte des Bauens wie auch des Wohnens auf dem Lande und in der Stadt zu erarbeiten. Damit der Gegenstandsforscher, der Museologe, das hochgesteckte Forschungsziel erreichen kann, das historische Wohnverhalten unterschiedlicher ländlicher Sozialgruppen in Niedersachsen in Buch- und Ausstellungsform dokumentieren zu können, bietet es sich für ihn an, als Primärquelle zunächst einmal die immer noch überaus zahlreich überlieferte Quellengattung “Haus“ allseitig mikroanalytisch zu befragen. In manchen Regionen Niedersachsens ist trotz immenser Kriegsverluste und trotz der Zerstörung wertvoller historischer Bausubstanz infolge veränderter Wirtschaftsstrukturen in der Landwirtschaft bis heute noch eine beachtenswerte Quantität und Qualität an ländlicher Bau- und Wohnkultur tradiert. Diese vielseitig ausdeutbaren Dokumente des “Hausens und Wohnens“ unterschiedlicher Bevölkerungs-
gruppen sind bisher eher zufällig als systematisch erforscht worden. Somit ist eine der anschaulichsten Quellengattungen zur Kultur- und Sozialgeschichte des Wohnens, zur Geschichte des “homo habitans“, bis dato von der Wissenschaft immer noch nicht erschöpfend genutzt.
Die Suche nach einer Antwort auf die Frage, wie man in den einzelnen Jahrhunderten auf dem Lande wohnte, ist nicht zuletzt deshalb schwierig und nur nach intensiver Forschungsarbeit erfolgreich, weil es ebenso wie in der Stadt auch in der ländlichen Region eine breit gefächerte Bevölkerungsgliederung nach Rang und Stand, nach feudaler Abhängigkeit oder persönlicher Freiheit, nach Beruf und Vermögen gab. Auch die Landbevölkerung wird unterschieden nach Honoratiorenschichten, Kaufleuten und Handwerkern, nach bäuerlichen Schichten mit unterschiedlichem Besitz und Recht sowie nach Schichten grundbesitzarmer und grundbesitzloser “Landleute“, wie Heuerleute, Tagelöhner, Knechte und Mägde.
Alle diese heterogenen Landbewohnerschichten sind bestrebt, in eigenen größeren oder mehr als bescheidenen Häusern, in für lange Zeit gemieteten oder nur in vorübergehend mietbaren “ Behausungen“ Wohnung zu finden. Das Niedersächsische Freilichtmuseum Cloppenburg versucht mit seinen derzeit über 50 historischen Originalbauten aus dem ländlichen Raum, diese vielfältigen und in den einzelnen Zeitperioden, Regionen und Sozialschichten stark voneinander abweichenden Wohnformen “hautnah“ erlebbar zu machen. Da aber selbst eine “ganzheitliche“, dreidimensionale Präsentation historischer Räumlichkeiten es nicht erreicht, die historische Realität der damaligen Wohnwelt, die Komplexität des Wohnens “begreifbar“ in die Gegenwart zurückzuprojizieren, ist die Methode der “Historisierung“, der Einbettung des Gegenstandes wie der Möbel und möblierten Räume sowie des Wohnens in ihnen in den Kontext der Zeit unverzichtbar.Ais dieser Einsicht heraus ist das Cloppenburger Museum bestrebt, nicht nur Sachdokumente zur Anschauung zu bringen, sondern durch Erschließen und Analysieren zusätzlicher archivalischer, literarischer und bildlicher Quellen das breite Spektrum der Wohnkultur zu beleuchten und nachprüfbar in Schrift, Bild und Ausstellung zu dokumentieren. Dies hat die Wissenschaftler des Museums (in Zusammenarbeit mit dem Seminar für Volkskunde, Universität Münster, Prof. Dr. Wiegelmann) motiviert, aufschlussreiche Schilderungen und Tagebuchaufzeichnungen der Bewohner dieser Räumlichkeiten zu sammeln und quellenkritisch zu edieren. Auf diese Weise sind zahlreiche Publikationen entstanden, die sowohl das Leben und Arbeiten am Herdfeuer im Rauchhaus als auch das Wohnen in Bauernstuben im Detail untersuchen. Bei genauerer Betrachtung der Wohnkultur wird deutlich, dass selbst das “niederdeutsche Halle Rauchhaus“, das bis zum Einbau des Schornsteins den Wirtschafts- und Wohnraum des Fletts ungeteilt als gemeinsamen “Luft- und Wirtschaftsraum“ bis zum Stall- und Dielenteil hin belässt, eine Wohnform darstellt, die sowohl “völlige Integration als auch Segregation“ je nach sozialer oder rechtlicher Stellung der einen oder anderen Bewohnergruppe bedeuten kann.
Als in den 70er Jahren eine neue Forschungsrichtung, die der Dokumentation der historischen Alltagskultur aufgrund der Auswertung serieller oder quantitativer historischer Quellen begründet wurde, um beispielsweise mit derartigen “Massenquellen“, wie Nachlassinventaren und Anschreibebüchern das soziokulturelle Agieren unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen und damit auch das Wohnverhalten in der jeweiligen Region- Zeit- Einheit zu analysieren (Seminar für Volkskunde, Universität Münster), beteiligte sich von Anfang an auch das Cloppenburger Freilichtmuseum an diesen neuartigen Wissenschaftsprojekten und konnte zahlreiche Publikationen zu diesen Themenbereichen veröffentlichen.
Da diese von den Wissenschaftlern des Cloppenburger Museumsinstituts vorgelegten Forschungsergebnisse auch in anderen historischen Disziplinen ein reges Echo fanden, konnte eine inzwischen ergebnisreiche Kooperation mit verschiedenen Forschungsinstituten der Regional-, Wirtschafts- und Bevölkerungsgeschichte (Universitäten Oldenburg und Göttingen) sowie der Sozialgeographie (Universität Osnabrück/Vechta) initiiert werden. Diese interdisziplinären Forschungsprojekte zur regionalen Kultur-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte sind sowohl mittel – wie auch langfristig angelegt und versprechen eine neue Forschungsqualität auch auf dem Sektor der “historischen Wohnkultur auf dem Lande“.
Prof. Dr. Helmut Ottenjahn,
Ltd. Museumsdirektor des Niedersächsischen
Freilichtmuseums “Museumsdorf Cloppenburg“
- Auszug aus 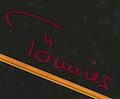 ANTIQUITÄTEN ALMANACH 1989/90 -
ANTIQUITÄTEN ALMANACH 1989/90 -
Hohenloher Schreinertradition
Hohenlohe, einstmals Territorium der gleichnamigen Adelsfamilie und ab 1806 Teil des Herzogtums bzw. Königreichs Württemberg, hat als reiches Bauernland zwischen 1750 und 1850 eine besonders große Zahl von Schreinerwerkstätten hervorgebracht, die qualitätsvoll gefertigte und originell bemalte Landmöbel herstellten. Obwohl die farbigen “Bauernmöbel“ der Landschaft schon seit Jahrzehnten Liebhaber und Sammler finden, hast sich die Forschung erst spät damit beschäftigt.
Naheliegenderweise rückte dabei eine Werkstatt in den Mittelpunkt, von der Möbel mit unverwechselbaren Signaturen erhalten sind – die Untermünkheimer Schreinerwerkstatt der Rößler.
Ausgehend von aufgemalten Meisternamen und Datierungen, durch Stilvergleich von Holzbearbeitung und Bemalung sowie durch chemische Farbanalysen konnten große Teile des Werks der fleißigen und einflussreichen Schreinerfamilie erschlossen werden; parallel dazu wurden Lebens- und Ausbildungsdaten der einzelnen Familienmitglieder aufgefunden, die nun zusammengenommen eine erste Skizzierung der Welt Hohenloher Landschreiner in den Jahrzehnten um 1800 zulassen. In Werk und Leben am deutlichen vor uns steht Johann Michael Rößler, der viele seiner Möbel signiert und mit dem Zusatz “Schreinermeister zu Münkheim“ verziert hat; seine Lebensdaten lassen sich wie folgt zusammenfassen: 1791 geboren, 1804 Lehrling bei seinem Vater, 1816 Meister, 1817 Heirat, 1829 “Zunftmeister“, 1834 “Schreinerobermeister“, 1843 zweite Heirat, 1849 gestorben. Bereits weniger klar erfassbar erscheinen sein Vater Johann Heinrich Rößler (1751 – 1832) sowie seine Brüder Johann Georg Rößler (1785 – 1844, zuletzt “Landmeister“ in Großaltdorf) und Johann Friedrich Rößler (1796 – 1863, Schreinermeister in Eschental), beide in der Werkstatt des Vaters Johann Heinrich ausgebildet und seit 1816 bzw. 1824 in den Haller Zunftakten als Meister ausgewiesen. Aber auch in dritter und vierter Generation arbeiten die Rößler als Schreiner: Johann Friedrichs Sohn Johann Michael führt die Eschentaler Werkstatt weiter, der Enkel (ebenfalls ein Johann Michael) taucht noch um 1900 als Schreinermeister in Weinsberg auf.
Im Mittelpunkt einer heutigen Werkbetrachtung dieser Familie stehen die Arbeiten des Johann Michael: blaugrundige Schränke, Truhen, Himmelbetten und “Tresuren“ (Aufsatzschränke), reich bemalt mit Rocaillen und Blumendekor, Lebensbaum und Vogelpaar, Früchtekorb und Füllhorn, vor allem mit den so charakteristischen Darstellungen von Bauer und Bäuerin in Festtagstracht oder mit Attributen der Feldarbeit. Daneben stehen, durch Stilvergleich mit frühen Arbeiten des populären Sohnes erschlossen, die seltener erhaltener und nie signierten Arbeiten des Johann Heinrich Rößler, Möbel mit noch dem Rokoko verhafteter Bemalung mit reichem Rocaillenschmuck und, in den Türspiegeln, mit adligen Porträts in ovalen Rahmen. Der Name Rößler ist nicht erst in den zwei letzten Jahrzehnten ein fester Begriff geworden, von “Rößler- Kästen“ hat man in Hohenlohe auf dem Lande schon immer gesprochen, wenn man mit Rocaillen, Blumenkorb, Amselpaar, bäuerlichen Figuren und herzhaften Sprüchen bemalte Schränke meinte. Aus dem bayrischen Mittelfranken ist bekannt, dass die dortigen Bauern zu den besonders hochwertigen farbigen Möbeln der Hohenloher Nachbarn ganz pauschal “Rößler- Kästen“ sagten. Zweifellos hat der in Deutschland so selten zu beobachtende Brauch des Signierens von Landmöbel, hat das “J.M. Rößler, Schreinermeister zu Münkheim“ zu dieser Sonderstellung beigetragen, hinzu kommt die originelle Darstellung von Bauer und Bäuerin, von Hund und Katze, von Amsel und Taube auf den Türspiegeln. Der Nimbus der Rößler- Möbel scheint auch nach 1850, als ein neuer Zeitgeschmack die alten Möbel mit ihrer “bäurisch“ farbigen Auszier aus den Kammern verbannte oder monochrom überstreichen ließ, nicht verschunden zu sein, denn viele Arbeiten der Untermünkheimer Schreiner sind bis heute in originaler Farbigkeit bewahrt worden.
In diesen Zusammenhang passt eine Bemerkung des Haller Konditormeisters, Kunstmalers und ehrenamtlichen Kustoden Conrad Schauffele, 1877 auf die Rückseite eines Schrankspiegels geschrieben, der Teil einer umfangreichen Möbelstiftung aus der Eschentaler Rößler- Werkstatt an das Stadtmuseum Hall war: “Füllung von einem sogenannten Rößler- Kasten, welche von Schreinermeister Rößler von ... in Münkheim bei Schwäbisch Hall gefertigt wurden und bei den Bauern der Haller und Hohenloher Gegend sehr gesucht waren. Die Kästen, Bettläden, Wiegen waren mit kleinen Sprüchen biblischen und scherzhaften Inhalts bemalt“. Die Inschrift lässt bereits 1877 Rößler- Möbel, die damals gerade 30 Jahre alt waren, zu beachteten “Museumsstücke“ werden. Gehen wir diese 30 Jahre zurück, so waren “Rößler- Kästen“ in sehr vielen Bauernhöfen Hohenlohes ganz selbstverständlich zuhause, galt die Untermünkheimer Werkstatt wohl als marktherrschend, ihr Stil als vorbildlich für benachbarte Werkstätten. Eine Aussteuer, in der Werkstatt des Johann Michael Rößler bestellt, muss damals als besonders prestigefördernd angesehen worden sein, so zu arbeiten wie die Rößler, muss für andere Landschreiner verkaufsfördernd gewirkt haben. Die Produkte der Rößler- Werkstatt in Untermünkheim, die man etwa zwischen 1775 (vermutliches Zuzugsdatum Johann Heinrich Rößlers nach Untermünkheim) und 1849 (Tod des kinderlosen Johann Michael Rößler) ansetzen kann, bestanden aus Möbeln und Einrichtungsstücken, wie sie für alle Landschreiner typisch waren: Kleider- und Weißzeugkästen, Küchen- und Aufsatzschränke als die repräsentativen Stücke, Truhen (nicht mehr nach 1820), Betten und Wiegen, Tische, Stühle und Bänke, sodann Schlüsselbretter und Tellerborde, “Straußenbretter“ (Blumenkästen am Außenfenster), Backtröge, Webstühle, Schnitzböcke u.a. Tatsächlich verhielt sich die Produktion eines Landschreiners zahlenmäßig im umgekehrten Verhältnis zum heute in Museen erhaltenen Bestand: am häufigsten hatte er einfache Bettladen und Sitzmöbel herzustellen, Aufträge für Schrank und Truhe sind viel seltener. Das tägliche Brot verdiente die Schreinerei, sicher auch die der Rößler, mit Särgen und Grabkreuzen, Mehl- und Hutzeltruhen, mit Verschlägen du Regalen, mit Türen, Fenstern und Läden.
Während sich von all den Alltagsarbeiten verständlicherweise nur ganz wenig bis heute erhalten hat, stehen wir immer noch vor einer erstaunlichen Fülle von ländlichen Großmöbeln des 17., 18. und 19. Jh. Angeschafft wurden die wichtigen Möbel – “Kästen“, “Behälter“ (meist Küchenschrank), gehimmelte Bettladen“, Wiege, Tische, Schranne (Bank), Sittel (Truhenbank) und Brettstuhl – meist anlässlich einer Hochzeit: Der Brautvater bestellte und bezahlte dieses “Schreinwerk“ der Aussteuer, der Schreiner richtete den offenen Brautwagen (Kammerwagen) her und begleitete ihn vor aller Augen durchs Dorf zum neuen Heim des Paares. Die große Bedeutung des Hochzeitswagens in Hohenlohe, mit dem man “Staat machen“ konnte, mag einer der Gründe für die nach 1800 immer reicher werdende Auszier der Möbel gewesen sein. In Verbindung mit bäuerlicher Form auf Hohenlohe und wahrscheinlich sogar auf Untermünkheim und seine Werkstätten um Rößler beschränkt. Es ist die “Tresur“, ein niedriger zweitüriger Schrank, zum Teil auf zwei gedrechselten Posten mit Bodenbrett ruhend und mit einem Stufenpodest als Abschluss gestaltet. Hinter den Türen verschloss der Bauer wichtige Dokumente, Geld, wohl auch das gute Besteck des Hauses, auf dem pyramidenartig getreppten Aufbau stellte die Bäuerin ihre schönen Gläser, Porzellan- und Zinnsachen auf. Als vergleichbare Möbel können Kredenz, Anrichte, Buffet, im höfischen Bereich der Kabinettschrank angesehen werden, die Hohenloher Tresur – mundartlich “Dresur“, in Inventaren “Drisur“, “Trisur“ oder “Thresoir“ genannt – hat als fernes Vorbild wohl als das “Dressoir“ bekannte gotische Möbel. In Flandern und Frankreich, dann im Rheinland und ganz Westdeutschland verbreitet und ins 16. und 17. Jh. tradiert, diente der Dressoir (von franz. “dresser“ = anrichten) als auf Stollen gesetzter Halbschrank zum Aufbewahren und – auf dem Podest – zum Anrichten und Zur- Schau- Stellen von Geschirr, Besteck und Speisen. Fast alle erhaltenen Hohenloher Tresuren stammen aus dem Umkreis Untermünkheim und besonders der Rößler- Werkstatt, wobei die älteren Arbeiten noch die vom gotischen Dressoir her bekannte Stollenkonstruktion zeigen (in die offene Bodenzone wurden Wasserkanne oder Becken gestellt), die späteren Möbel dagegen mit dem Korpus direkt auf dem Boden aufsaßen. Hohenloher Tresuren stellen ein Landmöbel dar, das aus der bürgerlichen Welt von Renaissance und Barock stammend, vom Landschreiner vereinfacht und einer Nutzung in der bäuerlichen Stube angepasst wurde.
Nach unserer Kenntnis gab es nur in den seltensten Fällen den Maler, der Bauernmöbel mit “Auszier“ versah, in der Regel bemalte der Schreiner seine Werke selbst. Die farbige Fassung wurde wohl auch nicht extra berechnet, vielmehr eiferten Schreiner mit ihren Künsten, und es kamen die Werkstätten zu den besten Aufträgen, deren Stil und Motive bei den Bauern besonders gut ankamen. Die so unterschiedlichen “Handschriften“ der einzelnen Werkstätten, zumeist in naiver Weise die Formensprache der großen Kunst in die ländliche Welt übertragend, prägt in ganz entscheidender Weise Volkskunst und ländliche Kultur, wie wir sie heute lieben und erforschen. Im Spektrum der Hohenloher Bauernmöbelschöpfer spielen die Rößler, noch vor den anderen bekannten, aber noch nicht mit konkreten Meisternamen zu verbindenden Werkstätten (etwa aus den Räumen Künzelsau, Waldenburg, Bartenstein, Crailsheim u.a.) die herausragende Rolle, Schränke und Tresuren mit den so auffallenden Porträtmedaillons und dem in Blau und Rot gehaltenen Rocaille- Schmuck der Jahre bis 1810, die routiniert komponierten Schrankfassungen aus gemalten Sockel und Bögen, Fruchtkörben und Füllhörnern, Lebensbäumen und Vogelpaaren, Blütenketten und Blattgirlanden des Johann Michael Rößler, schließlich seine bäuerlichen Porträtbildnisse im Medaillon und die freistehenden Figuren von Bauer und Bäuerin, Knecht und Magd mit den Attributen Pfeife und Blumensträußchen, Sense und Rechen ergeben eine farbige und doch einheitlichen Regeln folgende Möbelwelt, wie sie in dieser stilistischen Geschlossenheit und volkstümlichen Kraft in Deutschlands Südwesten ihresgleichen sucht.
Die unterschiede in der technischen und künstlerischen Detailausführung sind bei den bemalten Möbeln gleichwohl groß – es gelten hier andere Bedingungen als wir sie von den individuellen Schöpfungen der bürgerlichen, der “großen“ Kunst her kennen. Der Schreiner, der Maler auf dem Lande sieht seine Arbeit kaum als Kunstwerk, seine Person hat hinter dem Werk zurückzutreten. Stets arbeiten mehrere an einem Möbel (Meister, Geselle, Lehrling, Familienangehörige, Frauen, ja Kinder). Die Bemalung übernehmen die, die es am besten oder am schnellsten können; die schwierigen Teile der Auszier übernimmt der Meister, die Routine – Ornamente der Helfer – als Urheber der gemalten Porträts perückentragender Adliger oder perlenbehängter Hofdamen können wir uns auch eine Maler aus dem benachbarten Residenzstädtchen vorstellen. Vor diesem Hintergrund ist es schwierig, klare Werkstattzuweisungen zu treffen, klar umrissene Schulen und Stile festzuhalten. Sieht man von den signierten Möbeln des Johann Michael Rößler ab, so sind alle weiteren Untermünkheimer und vielfach den Rößler zugeschriebenen Möbeln nicht eindeutig zu identifizieren.
Wie erwartet ergaben genauere Nachforschungen in den Archiven eine Fülle von Schreinerwerkstätten, die vor, mit und nach den Rößler in Untermünkheim wirkten. Zeitgleich mit Johann Heinrich Rößler und der Blüte seiner Werkstatt, also in den Jahren von 1780 bis etwa 1810, arbeiten die Werkstätten Heinold, Glessing und Drechsel; Zeitgenossen und im kleinen Landstädtchen wohl auch unmittelbare Nachbarn der Werkstatt Johann Michael Rößlers (ca. 1810 – 1849) waren zusätzlich die Handwerkerfamilien Weller, Cronmüller, Braz, Lindenmeyer und Haag. Neben den Rößler die dominierenden Schreiner sind die Drechsel und Glessing, wobei vor allem der Namen Glessing in Zukunft größere Beachtung finden wird. Von 1707 bis heute sind 11 Generationen der Glessing belegt, in ununterbrochener Kette folgte ein Schreinermeister dem anderen bis hin zum 1985 noch in Rieden arbeitenden Friedrich Glessing. Nach den Unterlagen (Kiechenbüchern, Haller Zunftakten) müssen wir in Johann Georg Glessing (1707 – 1785), noch vor Johann Heinrich Rößler, den bedeutendsten Schreiner der Zeit sehen, bekannt auch als Ausstatter der umliegenden Landkirchen und möglicherweise Lehrherr des älteren Rößler. Einige herausragende Möbel, die bisher immer Heinrich Rößler zugeschrieben wurden, sind nun eher mit Glessing zusammenzubringen: das Himmelbett im Hällisch- Fränkischen Museum zum Beispiel oder Möbel im Württembergischen Landesmuseum Stuttgart (ein Himmelbett von 1806 oder ein doppeltüriger Schrank mit Engeln oder Heiligengestalten auf den Spiegeln). Damit ist auch angedeutet, dass die charakteristischen Untermünkheimer Bemalungsformen, die Rocaillen, vor allem die Porträtmedaillons auf den Spiegeln von Schrank und Tresur, keinesfalls eine Errungenschaft der älteren Rößler, sondern Stilformen der Zeit (und in so starken Maße an Möbeln allenfalls von Glessing eingeführt) sind. Ein künftiges Ziel der Möbelforschung in Hohenlohe wird sein, originale Arbeiten des Johann Georg Glessing zu finden und seine Rolle bei der Prägung des “Rößlerstils“, wie die Auszier auf blauem Grund in Hohenlohe vielfach generalisierend genannt wird, genauer aufzuzeigen.
Die große Zahl schöner und interessanter Hohenloher Landmöbel, vornehmlich aus dem Handwerkstädtchen Untermünkheim vor den Toren der ehemaligen Reichsstadt Schwäbisch Hall, bedeutet also immer noch ein lohendes Feld für Volkskundler, Kunsthistoriker und Sozialgeschichtler. Sie ist Auftrag für Museen und private Sammler, die im Besitz solcher wertvollen Stücke sind, sie ist reizvolle Aufgabe und Herausforderung für den Handel. Im Vordergrund jeder Beschäftigung mit den Untermünkheimer Bauernmöbeln steht die sorgsame Bewahrung dieser Beispiele eines einst so fruchtbaren ländlichen Handwerks für die Gegenwart und die Zukunft.
Dr. Heinrich Mehl,
Hohenloher Freilandmuseum, Schwäbisch Hall
- Auszug aus 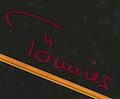 ANTIQUITÄTEN ALMANACH 1989/90 -
ANTIQUITÄTEN ALMANACH 1989/90 -
Möbelhölzer
Eine Einführung in die in den letzten Jahrhunderten am häufigsten für die Herstellung oder Dekoration von Möbeln verarbeiteten Hölzer.
Ahorn – acer saccharum.
Nord-, Mittel- und Südosteuropa bis Kleinasien. Gerad- und feinfaserig, oft auch “wellig“ oder mit sogenannten “Vogelaugen“. Verwendung: massiv, Furnier, Schnitzerei.
Farbe: weißlich-gelb.
Apfel – malus genus.
Europa. Verwendung: Massiv für Provinzmöbel, auch für kleine, gedrechselte Holzartikel, im letzten Jahrhundert auch für Furniere. Farbe: hell-rosa bis braun (leicht mit Kirsche zu verwechseln).
Bergahorn – acer pseudoplatanus.
Europa. Verwendung: Furniere, Marketerien. Farbe: glänzend, gelb, intensive Maserung.
Birke – betula alba.
Europa. Verwendung : Furnier, massiv für Drechsel- und Kunstschreinerarbeiten gebraucht. Farbe: weißlich-gelb, silbrig, zum Kern hin etwas dunkler; schöne gleichmäßige Maserung.

Birne – pyrus communis.
Europa. Verwendung : Schnitzholz, manchmal auch als Korpusholz, Furnier. Feine gleichmäßige Struktur (dem Lindenholz ähnlich). Farbe: rosa-rötlich bis gelblich, dunkleres Kernholz.
Buche – fogus sylvatica.
Zentraleuropa. Verwendung: massiv, z.B. als Stuhlrahmen (Bugholz), auch zur Imitation exotischer Hölzer (Bambus), mit Markstrahlen in Form von Flecken. Farbe: hell-gelblich, Kern vom Splint kaum zu unterscheiden.
Ebenholz – dyospyros crassflora.
Indien/Afrika. Verwendung: Einlegearbeiten und Furniere, schwer zu bearbeitendes, hartes Holz. Farbe: schwarzer oder dunkler, z.T. auch gestreifter, roter oder grünlicher Kern. Weitere Typen: Makassar Ebenholz, Koromandel.
Eibe – taxus baccata.
Europa. (Weichholz, Nadelbaum). Verwendung: als dekoratives Furnier, gelegentlich auch massiv verarbeitet, manchmal schwarz gebeizt (deutsches Ebenholz). Farbe: rötlich bis dunkelbraun.
Eiche – quercus robur; quercus petral ; quercus pedunculata ; quercus sessiliflora.
Europa. Verwendung : massiv verarbeitet für Korpus und Schubladen. Deutliche Markstrahlen (helle Streifen) und Poren, Jahresringe erkennbar; sehr hartes, schweres, dauerhaftes Holz, das von Eisen korrodiert wird (Verwendung als Dübel). Farbe: blassbraun bis braungelb, im Alter dunkelt die Naturfarbe nach.

Erle – alnus glutinosa.
Nordeuropa. Verwendung: Möbel-, Schnitz-, Drechsler- und Modellholz, auch für Furniere und Maketerie (Schweden). Farbe: blaß, rötlich-gelb, Hirnflächen des saftfrischen Holzes auffällig orangerot.
Esche – fraxinus excelsior.
Europa. Verwendung : massiv, Furnier, als Biegeholz geeignet (allerdings in der späteren Massenproduktion von Thonet und J&J. Kohn kaum mehr benutzt). Ausgeprägte, langfaserige Zeichnung. Farbe: weiß bis gelblich.
Fichte – picea abies.
Mittel- und Nordosteuropa. Verwendung: massiv, Furnier (weniger im Möbelbau, bevorzugt im Musikinstrumentenbau), Konstruktionsholz, vornehmlich im Innenausbau. Weicher als Kiefer (Kieferersatz). Farbe: weißlich bis strohgelb, manchmal rötlich. Harzkanäle.
Hainbuche – carpinus betulus.
Europa. Verwendung : Werkholz für Geräte und Maschinenteile, Drechslerholz, besonders in Frankreich für Korpusarbeiten benutzt. Farbe: hellgrau bis gelblich-weiß.
Haselnuß – corylus avellana.
Österreich und Deutschland. Verw.: Bauernmöbel und Furniere, geradfaserig. Farbe: rosa Tönung.
Kastanie – castanea vulgaris.
Europa. Ähnlich dem Eichenholz, aber ohne Markstrahlen. Verwendung: zum Furnieren großer Flächen (Südeuropa), auch in Frankreich sehr beliebt. Farbe: braungelb.

Kiefer – pinus sylvestris.
Europa und Sibirien. Verwendung: Korpusarbeiten, Konstruktionsholz im Innen- und Außenbau. In Frankreich verarbeitet, um Bambus zu simulieren. Farbe: weißlich gelb bis rötlich.
Kirsche – prunus avicum (avium).
Europa. Verwendung: massiv, Schnitzholz, Furniere (ausgeprägte, helle Furniere waren bei Biedermeiermöbeln sehr beliebt). Farbe: rötlich-gelb bis rotbraun, Splint deutlich heller als der Kern.
Lärche – larix decidua.
Europa. Verwendung: Verarbeitet für rustikale Möbel. Maserung ohne Knorren, ähnlich der Eiche, breite Jahresringe. Farbe: Kernholz rötlich braun, Spätholz dunkler.
Linde – tilia europae (cordata).
Europa. Verwendung: mit allen Werkzeugen gut zu bearbeiten, da sehr weich, gutes Drechsel- und Schnitzholz. Farbe: hell, gelblich-weiß, später nachdunkelnd, wenig Maserung.
Mahagoni – swietenia macrophylla (viele Arten).
Karibische Küste Zentralamerikas und tropisches Südamerika. Verwendung: weitgehend für Furniere. Farbe: Kernholz hell-braun bis rotbraun, unterschiedliche Maserungen und Färbungen. (Handwar-Mahagoni, Kuba-Mahagoni, Afrika-Mahagoni, Acajonholz...).
Nussbaum (Walnuß) – iuglans regia.
Südeuropa, Kleinasien, Nordindien, China, Afrika, Amerika. Verwendung: Furnier, massiv, Schnitzerei. Sehr dekorativ. Gut zu bearbeiten. Farbe: graubraun, gelblich-braun, rötlich-braun, bisweilen blaßgold.
Palisander – dalbergia latifolia.
(Brasilianisches Rosenholz = zarter Rosenduft) Brasilien (Riopalisander) Südostasien, Indien, Java. Schweres, hartes, dauerhaftes Holz. Verwendung: Ausstattungsholz für hohe Anforderungen; Drechslerholz; für Furniere in kleinen Teilen verwendet. Farbe: rötlich bis schokoladenbraun, durch dunkle Adern fast regelmäßig gestreift.
Pflaume – prunus domestica.
Europa. Ein sehr dekoratives Holz, langfaserig, feinporig. Verwendung: besonders für dunkle und helle Furnierstreifen. Farbe: rötlich braun (kann mit Kirsche verwechselt werden).
Rüster (Ulme) – Ulmus campestris.
Europa bis Südskandinavien. Gut bearbeitbares Holz mit ausgeprägter Maserung und gut gezeichneten Jahresringen. Verwendung: massiv, manchmal auch als Korpus, Furnier, auch Wurzelholz. Farbe: hellgrau bis gelblich (Splint), Kernholz hell- bis bräunlich rot, nachdunkelnd.
Sperrholz
Mehrere Furnierholzlagen werden verleimt. Diese Verleimmethode soll bereits im “alten“ China angewandt worden sein. Englische Kunstschreiner verleimten in der Mitte des 18.Jh. drei oder mehrere dünne Holzschichten, die Faserrichtung jeweils um 90° gedreht. Im 19.Jh. dann von besseren Herstellern eingesetzt, um Ziergitter und Galerien zu verstärken. Im frühen 20.Jh. dann allgemein in Gebrauch.
Teak – tectona grandis.
Indien und Burma. Sehr hart und schwer. Verwendung: massiv für Kolonialmöbel, Furnier (Burma-Teak). Farbe: Kernholz gelb, später hell- bis dunkelbraun, durch schwarze Adern lebhaft gestreift.
Wurzelholz
Von unterschiedlichen Bäumen werden Verwachsungen und Verästelungen zur Verarbeitung von Furnieren verwendet. Diese sind sehr dekorativ und hochgeschätzt.
- Auszug aus 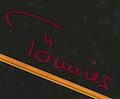 ANTIQUITÄTEN ALMANACH 1989/90 -
ANTIQUITÄTEN ALMANACH 1989/90 -
Intarsien-Kunst:
Kurze Geschichte einer langen Tradition
“Auslegen“ oder “Einlegen“?
“Intarsia“ – manche sagen auch “Intarsie“ oder verwenden einfach den Plural “Intarsien“ – ist ein altes Wort, das über das Italienische und Lateinische bis ins Arabische zurückgeht. In seiner ursprünglichen Bedeutung bezeichnete es vermutlich das “Auslegen von Mosaiken“, das Zusammenfügen von kleinen und kleinsten Teilen zu einem Bild. Schon in vorgeschichtlicher Zeit beschäftigten sich die Menschen mit dieser Kunst. In Ägypten verstanden es einzelne Meister bereits um 1600 vor Chr., echte Einlegearbeiten aus Elfenbein zu schaffen – ihre großartigen Zeugnisse edlen Kunsthandwerks prägten unseren heutigen Begriff: Intarsien, das kunstvolle Einlegen von verschiedenen Materialien wie Holz, echten Steinen, Gold, Silber, Perlmutt oder Schildpatt in die Vertiefungen einer massiven Holzplatte. Die Qualität einer Intarsie richtet sich immer nach Anzahl und Größe der eingelegten Teile und deren Feinheit und Anordnung. Im Altertum, später in Persien, vor allem aber im Europa der Renaissance und des Barock, gelangte diese Kunst zu großer Vollendung, nicht zuletzt deswegen, weil ab dem 16. Jahrhundert neuartige “Laubsägen“ extrem feine Schnitte erlaubten. Diese Zeit schuf sogar eine eigene Berufsbezeichnung – den “Marqueteur“.



Dieser genoss hohes Ansehen und arbeitete fast ausschließlich für den Adel und den Klerus. Neben den berühmten Intarsienkünstlern jener Epochen, Boulle und Roentgen, erreichte auch der Meister Damiano den Gipfel des Könnens. Von ihm ist überliefert, dass er sogar Kaiser
Karl V. in Erstaunen versetzte: Der Monarch hielt sein Intarsienbild zuerst für ein Gemälde. Erst durch einen Einschnitt ins Holz war er von der Echtheit der Intarsie zu überzeugen. Auch heute sind selbst Fachleute immer wieder verblüfft. Die Arbeiten aus unserer Werkstatt wurden 1980 von einem Fachjournal mit “Malerei“ verglichen.
“Meister Kohler“
Staatlich anerkannter Handwerksrestaurator
Kollnau
Kreuzstraße 15
7808 Waldkirch
- Auszug aus 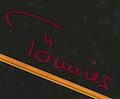 ANTIQUITÄTEN ALMANACH 1989/90 -
ANTIQUITÄTEN ALMANACH 1989/90 -