... / INFOTHEK / ANTIQUITÄTEN LEXIKON
ANTIQUITÄTEN LEXIKON
...
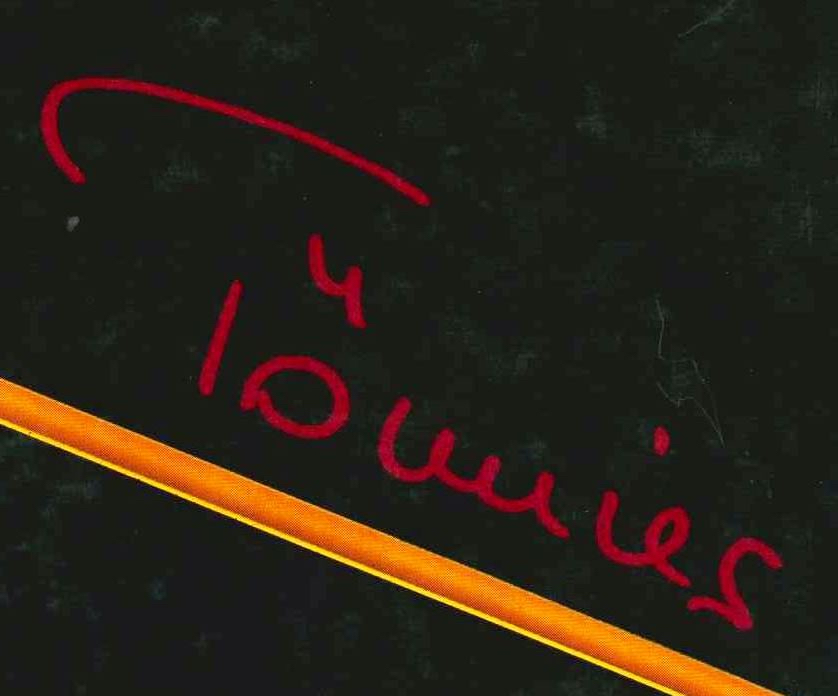
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Z
A
Aachener Möbel: In Natureiche gearbeitete Möbel des 18.Jh. mit feinen, üppigen Reliefschnitzereien, meist aus Rocaillen und Kartuschen, wie sie auch bei den Lütticher Möbeln vorkommen. Vor allem Schreibmöbel, Schränke, Aufsatzvitrinen und Anrichten, aber auch Sitzmöbel.
Ablassbilder: Seit dem 15.Jh. vorwiegend als Kupferstiche vorkommende, kleine Bilder mit auf Buße und Sündenvergebung bezogenen, religiösen Motiven.
Absperrung: Konstruktion, die durch Gegeneinanderstellen der Maserrichtung von Furnier und Trägerholz die Bewegung des Trägerholzes auf das Geringste reduziert und somit die Rissbildung im * Furnier verhindert.
Adam, Robert (1728 1792): Bedeutender schottischer Architekt und Innenausstatter. Begründer des klassizistischen "Adam Stils", bei dem sich Elemente des engl. Palladianismus, der griechischen u. römischen Antike u. der ital. Renaissance verbinden.
Adelaide Frisur: Biedermeierhochfrisur, mittelgescheitelt mit anmodelliertem oft schwarzem Haar, seitlich über den Ohren gebauschte Lockentuffs und kunstvoll aufgetürmter Haarkrone am Oberkopf.
Aedikule: Von Gesims tragenden Säulen flankierte Nische.
Ahorn: Sehr edles Holz. Keine deutlich abgegrenzten Jahresringe. Aufgrund seiner Elastizität ist Ahorn für Einlegearbeiten in Holz optimal geeignet.
à-jour-Fassung: Begriff aus dem Schmuckbereich. Auf der Rückseite des Steinträgers durchbrochene, lichtdurchlässige Fassung von Edelsteinen.
Akanthus: Distelartiges, oft eingerolltes Blattornament, das einzeln oder in Ranken vorkommt und nach der Bärenklaupflanze der Mittelmeerländer benannt ist. Schon im 5.Jh. v. Chr. fand dieses Ornament Anwendung. Reichstes Anwendungsgebiet irrkorinthischen Kapitell, sowie später in allen antikisierenden Epochen. Bes. zur Zeit der * Renaissance und des * Barock kam das Ornament wieder zur Geltung und blieb in allen Ornamenten der Möbelkunst vorherrschend bis 1800.
Almosenschale: Breitrandige Schale für den kirchlichen Gebrauch u.a. aus Silber, Zinn, Bronze; in ganz Europa seit dem MA verbreitet, Bronzeexemplare, teilweise mit erhobenem Dekor (biblische Szenen u.ä.) bes. in Süddeutschland.
Altaruhr: Ital. Uhr mit hölzernem Gehäuse u. mit dem Aussehen eines Altars. Mitte 17. bis 18.Jh. auch in Süddeutschland.
Anrichte: Halbschrank mit Türen oder Schubladen und Aufsatz mit Borden zur Aufbewahrung von Geschirr.
Ansbacher Fayence: 1709 errichtete Fayencemanufaktur, (Gründer. Markgraf Wilhelm Friedrich); die Manufaktur arbeitete bis 1839, zuletzt als Steingutfabrik; die Erzeugnisse tragen mit * Arabesken und Laubwerk bemalte Ränder in tiefem Blau; ab 1730 Vogelmalerei (Geschirre u. v. a. große Vasensätze).
Ansbacher Porzellan: Im Gebäude der Fayencefabrik 1758 gegr. Porzellanmanufaktur (Gründer: Markgraf Alexander, der Schwager Friedrichs des Großen; 1762 wurde die Porzellanherstellung in das Jagdschloss Bruckberg verlegt; geschlossen 1860; Erzeugnisse waren: Kopien nach Berliner Geschirrformen und Figuren, vor allem eines der graziösesten Geschirre der Zeit, das sog. "Ansbacher Muster" (Adler, ein Bach mit Fischen in Unterglasurblau).
antik: (Lat. = alt); im Kunsthandel auch allg. als alt im Gegensatz zu modern gebräuchlich.
Antiquität: Ein altertümlicher Gegenstand.
antiquiert: veraltet.
Apothekenschrank: Im Auftrag für Apotheker errichtete Schränke, mit zahlreichen kleinen Schubladen, welche beschriftet zum Aufbewahren von Medikamenten dienten.
Appliken: Urspr. angesetzte, selbständig gearbeitete Zierstücke (in der Möbelkunst * Beschläge); ein und zweiarmige Wandleuchter werden ebenfalls Appliken genannt.
Arabeske: Streng symmetrisch aus einer Blattvolute nachgebildetes Rankenornament, stammend aus der hellenistisch-römischen Kunst.
Arbeiten: Darunter versteht man die Eigenschaft des Holzes, auf klimatische Veränderungen durch "Sicht-Werfen", Ausdehnen oder Schwinden zu reagieren.
Architrav: Aus der antiken Baukunst entnommenes Element (* Gesims), das zwei Säulen horizontal verbindet.
Armoire à deux Corps: Halbschrank mit schmälerem, zurückgesetztem, zweitürigem Aufsatz; hauptsächlich Frankreich z. Hälfte 16.Jh.
Armstuhl: Aus einfachem Stuhl entworfenes Sitzmöbel m. seitlichen Stützen für die Arme; (Kirchen , Thronstuhl). Im 18.Jh. wurde die Armlehne oft mit einem kleinen Wulst gepolstert.
Art Deco: Bz. für eine Stilrichtung des Kunstgewerbes, die auf den * Jugendstil folgte und ihren Höhepunkt zw. dem Ersten und Zweiten Weltkrieg erreichte; geht auf eine Ausstellung zurück, die 1925 mit dem Titel "Exposition des Arts Decoratifs et Industriels Modernes" in Paris stattfand. Die neuen Kräfte, deren symmetrisch linearen Gestaltungsprinzipien sich zunächst in Frankreich auswirkten, griffen schnell auch auf Mitteleuropa und Amerika über, wo z.B. die holländische Bewegung "De Stijl", das "dt. Bauhaus", die "Wiener Werkstätten" und die Arbeiten des am. Designers Frank Lloyd Wright ähnli¬chen Vorstellungen huldigten.
Atlant: Kräftige maskuline Gestalt als Gebälkträger; Gegenstück zur femininen * Karyatide.
Aufbauschrank: * Überbauschrank (vgl. auch das frz. Armoire ä deux corps).
Aufdoppelung: Aufeinanderleimen von Brettern mit gegenein¬ander versetztem Faserverlauf, wodurch das "* Arbeiten" des Holzes verhindert werden soll.
Aufsatzbuffet: Reich gegliederter, zweitüriger Halbschrank, worauf zurückgesetzter, regalartiger Aufsatz steht, dessen Kopf baldachinartig vorspringt u. vorn von Säulen gestützt wird.
Aufsatzkommode: Mehrschübiges, meist geschweiftes Kom¬modenteil mit einem oft leicht zurückgesetzten, meist zwei¬türigen Aufsatz.
Aufsatzschrank: Sog. Doppel oder zweigeschossiger Schrank.
Aufsatzsekretär: Wie die * Aufsatzvitrine wurde der Aufsatz¬sekretär mit zweitürigem Schrankunterteil oder Kommodenun¬tersatz geschaffen. Mit Unterteil, aufgesetztem Zwischenteil mit Schreibklappe und Aufsatz war er das beliebteste Möbel¬stück des 18.Jhs. in Deutschland.
Aufsatzvitrine: Zweitüriges Schrankunterteil oder mehrschübiger Kommodenuntersatz mit meist dreiseitig verglastem, zweitürigem Vitrinenaufsatz.
Augsburger Kabinett: Ein Zierschränkchen ("Kunstkammerschrank") aus Edelholz, oft Ebenholz, mit Untergestell aus acht Stützen, Fußplatte und Kugelfüßen. Der Augsburger Kabinett¬schrank ist zweitürig und enthält zahlreiche, um ein Schließfach gruppierte Schubladen. Er ist mit * Intarsien aus Elfenbein, Perl¬mutt, Edelsteinen und Miniaturen reich verziert.
Augsburger Silber: Im 18.Jh. erlebte das Silbergerät seinen Höhepunkt (Tafel und Toilettengerät, Einrichtungsgegenstän¬de, eine Fülle von Gefäß und Gerätetypen); Paris wirkte in die Silberschmiedekunst in Augsburg ein. Augsburg war von da an die Silbermetropole, die, an Leistungsfähigkeit unerreicht, ganz Europa mit Silbergerät belieferte.
Autoperipatetikos: (Griechisch: Der Selbstläufer); in Amerika von E.R.Morrison erfundene und 1862 in England von A.V.Newton patentierte Puppe mit einem Laufmechanismus unter dem Rock, der einem Uhrwerk ähnlich die Metallfüße bewegt. Meist mit einem Porzellan oder Pariankopf auf einem gestopften Körper.
B
Badepuppen: Porzellan oder Biskuitpuppen aus einem Stück mit aufgemalten Haaren und Gesichtszügen. Charakteristisch der stämmige Kinderkörper mit leicht gegrätschten Beinen, ab-gewinkelten Armen und Fäusten. Zw. 1870 und 1890 in Mode.
Baldachin: Urspr. "Traghimmel" aus kostbaren Stoffen, auf vier Stäben bei Prozessionen über dem Allerheiligsten getragen; später auch als fest montierter "Himmel" über Thronen und Altären angebracht; bei Bauernmöbel vorkommend als "Betthimmel" über den sog. Himmelbetten (Baldachinbett).
Bald Head: Runder, geschlossener Puppenkopf mit aufgemal¬ten Haaren oder einer Perücke.
Balg: Puppenkörper aus Stoff, Leder, Filz oder ähnlichem Material, gestopft mit Rosshaar, Watte, Korkstückchen, Wolle oder Sägemehl.
Ballettfiguren: Früheste Stücke aus Porzellan; aus Ludwigsburg stammend; 1760 bis 1765 modelliert von J.J. Louis; ganze Serien auch von F.C. Linck in Frankenthal.
Ballkopf: Wachskopf, dessen Haar in einem Schlitz auf dem Scheitel eingesetzt ist.
Baluster, Balustrade: Kurzes, stark gebauchtes (kegelähnlich) Säulchen oder Doppelsäulchen, zu Geländern ("Balustrade") nebeneinander gereiht. Im Möbelbau schon seit der Antike als Stützelement verwendet.
Bandelintarsie: Vereinfachtes * Bandelwerk, * Intarsie.
Bandelwerk: Reich geschwungenes, verflochtenes, meist mit Laubwerk, Gehängen und Figuren durchsetztes Bandornament der * Renaissance und des * Barock.
Bank: Sitzmöbel für mehrere Personen; im frühen MA wandfest; ab dem 12.Jh. mit gedrechselten Hölzern verzierten Seiten- und Rückenlehnen. Zu den ältesten Beispielen gehören die Chorbänke im Kloster Alpirsbach, Schwarzwald. Im 15.Jh. Verschmelzung mit der Truhe zur * "Truhenbank", oft mit beweglicher Rücklehne. In der ital. Renaissance wurden bes. kunstvolle Truhenbänke hergestellt, die man * "Cassapanca" nennt. Als die Bank in der zweiten Hälfte des 17.Jh. gepolstert wurde, nannte man sie * "Canapé" (dt.: Kanapee).
Banquette: * Bank ohne Lehne, häufig auf acht Beinen; im Deutschen auch Ruhebett genannt.
Barockstil: Kunstepoche von ca. 1600 bis 1760; zu unterteilen sind: Frühbarock 1600 1630, es folgt: Hochbarock u. gegen 1735 als Spätbarockstil das * Rokoko, bis ca. 1760.
Base: * Säule, Säulenfuß (Basis).
Bastionsfüllungen (Bastionsstil): Auch Festungsfüllungen nennt man die profilierten * Füllungen, die stilisierten Festungsdraufsichten ähneln; bei vielen Schränken der Barockzeit findet man diesen Stil.
Bauernmöbel: Sehr charakteristisch geprägtes, traditionsgebundenes Mobiliar der Bauern. Bauernmöbel sind im Gegensatz zu höfischen u. bürgerlichen Möbeln in ihren Grundformen ohne wesentliche Fremdeinflüsse. So zeigt sich ihre Bodenständigkeit vor allem in der Verwendung regionaler Holzarten. Nordd. rustikale Möbel z.B. sind primär in Eiche, südd. Bauernmobiliar hingegen überwiegend aus Nadelhölzern gefertigt.
Bayreuth: Dt. Fayencemanufaktur; 1719 von J.C. Ripp in Schloss Georgen am See gegr.; 1728 verpachtet an den Kriegskommissar Johann Georg Knöller; unter ihm entstanden die schönsten Werke; dunkelbraun und gelb glasierte Stücke oft mit * Chinoiserien und Jagdszenen in Gold oder Silber bemalt ("braune Ware", "gelbe Ware"), * Fayencen in blassen Scharffeuerfarben und glatte, weiße Fayencen); 1852 geschlossen.
Bayreuther Hausmalerei: Um 1751 Bemalung von Porzellan und Fayence ("Muffelmalerei"); vorzüglich gemalte dt. Blumen; die bedeutendsten Bayreuther Hausmaler waren Johann Friedrich Metzsch und Johann Christoph Jucht.
Bebepuppen: Puppen, welche Kinder bis ca. sieben Jahre darstellen; markant sind die großen strahlenden Augen u. der kindliche Gesichtsausdruck; Kugelgelenkkörper aus Holz, ab 1870 Nachfolger von den sog. Ladydolls..
Bekrönung: Bz. für den abschließenden Teil eines Schrankes (* Giebel, Kranz).
Berain, Jean (1637 1711): Pariser Architekt, Möbelentwerfer und Ornamentstecher; Erfinder des * Bandelwerks.
Bergere: Breiter, tiefer allseitig gepolsterter Rokokosessel; um 1730 aus der Form des * Fauteuils entwickelt.
Berliner Fayence: Vom Großen Kurfürst 1678 errichtete Fayencemanufaktur, die 1697 in den Besitz von Gerhard Wolbeer gelangte und bis 1786 von dessen Nachkommen betrieben wurde; (Birnkrüge mit weitem Hals, Walzenkrüge und große Vasen, die mit * Chinoiserien in bunten Scharffeuerfarben bemalt sind). Weitere bedeutende Fayencemanufakturen: Cornelius Funcke (gegr. 1689, geschl. 1750; Johann Gottfried Menicus (Berliner Fayencemaler) (gegr.1748, geschl. 1760); Carl Friedrich Lüdicke (gegr. 1756). Von den vier Berliner Manufakturen führte nur Lüdicke ab 1778 eine Marke.
Berliner Porzellan: Porzellanmanufaktur; im Jahre 1751 von dem Wollzeugfabrikanten Wilhelm Caspar Wegely gegr.; (derbe Geschirre mit steifer Bemalung und Vasen mit Reliefdekor); 1757 schon geschlossen; daher sind Wegelyporzellane sehr selten. Weitere Berliner Porzellanmanufakturen: Johann Ernst Gotzkowsky (1761 bis 1763), 1763 von Friedrich dem Großen übernommen. Sie besteht noch jetzt als Staatliche Porzellanmanufaktur (heute in Selb).
Beschläge: Urspr. Eisenbänder mit bestimmter praktischer Funktion, z.B. zum Verschließen von Truhen etc., später zu Schmuck und Ziermotiven (Schlüsselschilder, Handgriffe) umfunktioniert. (* Appliken).
Beschlagwerk: Aus dem * Rollwerk entwickeltes Ornament, bestehend aus symmetrisch angeordneten, winkelig gebrochenen Bändern, Leisten und flachen geometrischen Körpern. Es wurde vom holländischen Ornamentenstecher Hans Vredeman de Vries erfunden. Sind die Bänder mit * Voluten durchsetzt und stark geschwungen, spricht man von "Schweifwerk".
Betschrank: Schränkchen zur Aufbewahrung von Gebets und Gesangbüchern mit einem Betschemel kombiniert (Prie-Dieu).
Bett: Im MA fest in den Raum eingebaut; es hatte, wie ein selbständiges Gemach, eine Decke und zwei oder auch drei geschlossene Wände, die mit Schnitzereien verziert waren (Kastenbett); die offenen Seiten konnten mit Vorhängen geschlossen werden.
Bibliotheque hasse: Niedriger Bücherschrank des 18.Jh., häufig mit Glastüren.
Biedermeier: Der erste bürgerliche Kunststil, der zw. 1815 ("Frühbiedermeier") und 1848 ("Spätbiedermeier") Gültigkeit hatte; mehr oder minder starke Ansätze in ganz Europa. Zentren: Deutschland (Möbelkunst) und Österreich (Wien). Das Biedermeier entwickelte sich aus dem * Empire und ist eine Folge der Verarmung nach den "Napoleonischen Kriegen", in seiner Schlichtheit und Nüchternheit eine Reaktion auf den Prunk von * Rokoko und * Klassizismus (Emanzipation des "Mittelstandes").
Birkenholz: Hartes, schön gemasertes Holz, das im 18. und frühen 19.Jh. vorwiegend für Furniere (* Furnierung) verwendet wurde.
Birnbaumholz: Dichtes, sehr hartes Holz, rötlich gelb bis rotbraun; da es schwarze Beize gleichmäßig aufnimmt, diente es auch als Ersatz für * Ebenholz.
Biskuit: Zweifach gebranntes Porzellan ohne Glasur; Bemalung nach dem ersten Brand. Biskuitpuppenköpfe wurden vor 1890 meist gepresst, später gegossen.
Blattgold, ("Häutchengold"): Pures Gold, das zw. Goldschlägerhäutchen (Rinderdärmen) bis zu einer Dünne von 0,00014 mm ausgeschlagen wurde; diese Goldblättchen verwendete man zum Vergolden von Bucheinbänden, Schnitzfiguren u.ä., aber auch für Möbel.
Blindholz: Unedles Trägerholz, auf welches das * Furnier geleimt wird.
Bodenseeschrank: Ende des 18.Jhs. am Bodensee entstandener, sehr charakteristischer Schranktyp; meist mit Kugelfüßen; aus zwei, in der Mitte verkeilten Schrankhälften zusammengeschoben; eine unten abgesetzte Profilleiste täuscht einen Sockel vor; die Front ist oft leicht gebaucht, die Ecken sind abgeschrägt; meist in massiv Kirsch- oder Nussbaum gearbeitet; mit zeitgenössischen Ornamenten intarsiert.
Böhmische Möbel: Unverkennbare österr. Einflüsse, bes. bei den zahlreichen Erzeugnissen des 18.Jh.; etwas kantigere Möbel; an Stelle von Schweifungen treten häufig gebrochene Kanten; die Füllungsfurniere sind meist aus Nussbaum, kleingemasertes Wurzel oder Birkenholz; neben Bronzebeschlägen sind bes. verzinnte Eisenbeschläge beliebt.
Bonheer-du-jour: Kleiner Damenschreibtisch, zugleich * Toilettentisch, auf hohen Beinen, mit zurückgesetztem Aufbau; um 1760 in Mode.
Bogenfries: Bogenornament am * Gesims von Truhen und Schränken, das sich regelmäßig wiederholt.
Bordüre: Gemusterter Rand von textilen Geweben; bei Möbeln Bz. für ornamentale Umrahmungen von Malereien.
Bosse: Ein der Verzierung dienender Buckel; kräftig ausgebildet nennt man sie bei * Füllungen "Kissen".
Bouche ferme: Begriff aus der Puppenwelt; bedeutet "geschlossener Mund".
Boulle, Andre Charles (1642 1732): Einflussreichster Pariser * Ebenist unter Louis XIV; berühmt geworden durch die nach ihm benannte * "Boulle-Technik".
Boulle-Technik: Von * André Charles Boulle erfundene Technik des Furnierens (* Furnierung) mit Schildpatt und Messing, seltener auch mit Elfenbein und Zinn. Platten unterschiedlichen Materials wurden aufeinandergepasst; in der oberen wurde das Muster ausgesägt, die Platten zusammengeleimt und dem Möbel aufgelegt.
Böttger, Johann Friedrich (1682 1719): * Meißen.
Bramahschloss: Sicherheitsschloss, im Jahre 1784 von J. Bramah entwickelt.
Brandmalerei: Einbrennen von Ornamenten, Mustern und Darstellungen in glattes Holz mit glühendem Eisen, im späten 19.Jh. an Möbeln beliebt.
Braunschweiger Fayence: Manufaktur, 1707 von Herzog Anton Ulrich gegr.; die Erzeugnisse glichen denen von Rouen, * Delft, später * Berlin (Maßkrüge mit fürstlichen Monogrammen); die Glasur Braunschweiger Fayencen ist stumpf; als Marken treten die Monogramme VH, B & R, BR & C auf. Eine weitere Fayencemanufaktur in Braunschweig gründete 1747 Anton Chely mit seinen Söhnen, die bis 1757 bestand.
Braunschweiger Möbel: Vom Hofe Wolfenbüttels beeinflusst entwickelte sich in Braunschweig eine charakteristische bürgerliche Wohnkultur, deren Möbel im höfischen Ursprung verwurzelt blieben; Einflussgebiete: Niedersachsen bis Thüringen und Westerwald; traditionell konservative Formen; bes. markant sind die Aufsatzmöbel; die * Aufsatzkommoden und * Sekretäre haben meist gegliederte Kugelfüße, die Unterteile sind dreischübig, mit abgeschrägten Ecken, oft mit vorgesetzten * Lisenen, oder abgerundet. Der typische Braunschweiger Schrank des 18.Jhs. ist in hellem Nussbaum furniert, zweitürig, hat ein hohes Sockelgeschoss mit vorgetäuschten Schubladen und steht meist auf wuchtigen Kugelfüßen; er trägt häufig figürliche Elfenbeineinlagen.
Brauttruhe: (Hochzeitstruhe); sehr kostbare * Truhe, die die Braut als Morgengabe zur Aufbewahrung der Aussteuer erhielt; Szenen, bezüglich Liebe, Treue und Tugend weisen im Dekor auf diese Bestimmung hin.
Brettschemel: Aus dem ital. * Sgabello entwickelter Stuhl; seit dem 16.Jh. in Deutschland verbreitet; im 17. und 18.Jh. bes. im bäuerlichen Bereich Gebrauch.
Brettstuhl: Runder, ovaler oder trapezförmiger Sitz, in den Lehne und Beine einzeln eingefügt wurden.
Briefpaneel: Holländisch für * Faltwerk.
Bronzemöbel: Fein gegliederte Liegen aus Bronze, in Pompeji gefunden, weisen darauf hin, daß die Römer Möbel aus Metall gekannt haben.
Bronzeschuhe: Im * Barock, bes. aber im * Rokoko beliebte Umkleidung der Füße vor allem bei Kleinmöbeln.
Brotschrank: In Westdeutschland und Ostfrankreich gebräuchlicher Schrank, oft in Form von Halbschränken mit mindestens einer offenen Füllung zur Durchlüftung des aufbewahrten Brotes.
Brustkopf: Kopf und Bruststück unbeweglich in einem Stück gearbeitet.
Buche: (Rotbuche); Sehr hartes Holz, das bes. gerne für Stuhlgestelle u. Schrankfüße sowie einfache Möbel verwendet wird.
Bücher oder Bibliotheksschrank: Benannt nach seiner Verwendung; regalartig durchgehende Innenfächer ermöglichen die Aufnahme und Verwahrung vieler Bücher.
Buffet: (Büffet) * Anrichte, Kredenz
Bugholz: Von * M. Thonet um 1830 entwickeltes Verfahren, bei dem unter Wasserdampf meist * Ahorn und * Buchenholz gebogen und zu Stühlen verarbeitet wurde.
Bureau-plat: Langer, flacher Schreibtisch mit zwei bis drei Schubladen unter der Tischplatte, gegen Ende des 17.Jhs. in Frankreich entstanden.
Bureau toilette: * Bonheer du ;jour.
Butterfly Tisch: amerik. Klapptisch, frühes 18. Jh., auswärts gestellte Beine. Unter der hochgestellten Platte Stützen in Schmetterlingsform.
Bye-Lo-Baby: Babypuppe, 1922 von Grace Storey Putnam nach einem drei Tage jungen Säugling modelliert und nach diesem Modell von Borgfeldt in New York produziert.
C
Cabinet d'Allemagne: * Kabinett.
Cabinet-maker: ("joiner"); engl. Bz. für Kunstschreiner (* Ebenist) im Gegensatz zu * chair maker.
Cabriole leg: (=Bocksfuß); zügig geschweifter Fuß an engl. Möbeln, welcher der stilisierten Hinterhand eines Tieres nachgebildet ist; Ende des 17.Jhs. in Europa häufig verwendet.
Canape: (Kanapee); ein dem * Sofa ähnliches Sitzmöbel des 18.Jahrhunderts mit hoher Rückenlehne und offenen oder geschlossenen Seitenlehnen.
Caquetoire: (Vom franz. "caqueter" = plaudern); tragbarer Damenstuhl mit Armlehnen, schmalem, hohem Rücken und trapezförmiger Sitzfläche, die nach vorne breiter wird; im 16.Jh. in Frankreich aufgekommen und später von England und den Niederlanden übernommen.
Cartapesta: Vortäuschen von Schnitzerei durch Reliefauflagen aus * Papiermache.
Cartonnier: (Serre Papier); frz. Gestell des 18.Jhs. für Schreibmaterial; mit mehreren Schubladen und Fächern versehen; manchmal auch mit Bronzeornamenten u.ä. geschmückt; es wurde an oder auf den Schreibtisch gestellt.
Cassapanca: Ital. Truhenbank mit Seitenlehnen, Rückwand und Fußpodest; entworfen im 15.Jh. aus einer Kombination von Wandbank und Truhe; entwickelte sich im 16.Jh. zum edelsten Möbel der ital. Renaissance.
Cassetone: * Anrichte.
Cassone: Ital. Prunktruhe des 14.Jhs. mit geschnitztem, vergoldetem Dekor; im 15.Jh. mit Bemalung und im 16.Jh. mit Architekturformen verbreitet.
Causeuse: Marquise; schmales frz. Sofa des 18.Jhs. für zwei Personen; in England auch Love Beat genannt.
Chair maker: (Engl.) Stuhlmacher; für einfache Tischlerarbeiten zuständig (* Cabinet-maker).
Chaise à la gondole: (Gondelstuhl); klassizistischer Stuhltyp mit muldenförmiger Rückenlehne; im späten 18.Jh. in Frankreich entstanden.
Chaiselongue: Mitte des 18.Jhs. in Frankreich auftretendes Ruhebett (* Duchesse); aus dem Stuhl durch Erweiterung der Sitzfläche entstanden.
Charakterpuppen: Lebensechte Puppentypen; meist nach Babys oder Kindern modelliert.
Chiffonniere: (Pfeilerkommode); schmale, hohe Kommode mit bis zu zwölf Schubladen für Damenwäsche und Accessoires, die man vor Pfeilern zw. Fenstern aufzustellen pflegte; bes. beliebt im Zeitalter Ludwigs XV. und Ludwigs XVI.
China-Head-Puppen oder Chinoisepuppen: Puppenköpfe oder vollst. Puppen, hergestellt aus glasiertem Hartporzellan.
Chinoiserien: Schmuckformen des * Hochbarock und des * Rokoko; nach Chin. und Japan. Idolen gestaltete Dekorationsmotive; auch in bäuerlicher Möbelmalerei vorkommend.
Chippendale, Thomas (1718 1779): Bedeutendster engl. Möbelschöpfer, seit 1753 in London; er bildete Möbel des * Queen-Anne-Stils (* Barockstil) unter Verwendung ostasiatischer, neugotischer (* Historismus) u. frz. Elemente um u. prägte den engl. Möbelstil des * Rokoko; er bevorzugte als Material * Mahagoni oder Weichholz m. Lack und Vergoldung.
Claw-and-ball-foot: Von Tierkrallen(Vogelfüße)umspannter Kugelfuß; beliebtes Stützmotiv engl., später auch holländischer Sitzmöbel im 18.Jh.
Cloisonne: Emaillearbeit, deren Schmelzfelder durch Metallstege abgegrenzt sind; Blütezeit im MA.
Club foot: (Am. Bz. "Dolch foot"); keulenförmiger Fuß an engl. Sitzmöbeln des 18.Jhs.
Composition oder Mischmasse: Werkstoff zur Puppenherstellung aus ca. 100 Teilen Leim, 25 Teilen Glyzerin, Wachs, Zinkoxyd und Wasser sowie weiteren Bestandteilen wie Lederresten oder Gummi; diese Masse wird erhitzt und dann in Formen gepresst oder gegossen.
Contour è farbalete: (Frz. = Armbrustbogen); wie der Bogen einer Armbrust geschwungene Zarge im * Rokoko.
Creußener Steinzeug: Das berühmteste Steinzeug des 17.Jhs. wurde in Creußen bei Bayreuth (am bekanntesten war die Familie Vest) hergestellt; der Scherben ist bes. hart und absolut säurefest; (Erzeugnisse waren: Apothekergefäße wie Schraubflaschen und Salbentöpfe, Weinkannen und Trinkkrüge).
D
Dachtruhe: Frühmittelalterlicher Truhentyp aus Nadelholz mit Klappdeckel als Satteldach.
Dadaismus: (Von dada als Stammellaut der Kindersprache), wurde von H. Ball als Schlagwort geprägt und war Titel einer 1916 in Zürich um den rumänischen Philosophiestudenten Tristan Tzara gebildeten radikalen Künstler und Literatenbewegung (der Dadaisten), die die Rückkehr zur "schöpferisch" kindlichen Primitivität verlangte und in ihren die bisherigen Kunstformen zerstörenden Werken die behauptete Sinnlosigkeit der Welt zu spiegeln suchte. Der D. breitete sich bis nach Amerika aus, ging aber bereits in den 20er Jahren zum Surrealismus über. Hauptvertreter: H. Ball, R. Hülsenbeck, K. Schwitters, Max Ernst, A. Breton.
Danielstaler: Münze des 16.Jhs.; in Jever, Friesland geprägt; mit dem Bild Daniels in der Löwengrube auf dem Revers.
Danziger Schrank: Schwerer, typisch norddeutscher zweitüriger Barockschrank auf gekanteten Kugelfüßen mit * Pilastern und abgeplattetem Giebel, der mit reichem Schnitzwerk, Blatt-girlanden und Fruchtgehängen sehr repräsentativ gestaltet ist; er war der wichtigste Schranktyp Ende des 17.Jahrhunderts neben dem * Hamburger Schrank.
Danziger Tisch: Schwerer Barocktisch mit gedrehten Beinen, die über den Kugelfüßen durch Querhölzer in Form eines doppelten Ypsilon verbunden sind; die * Zargen betonen mit reichen Schnitzereien die wuchtigen, barocken Formen.
Day-bed: Schmales Ruhebett auf sechs Beinen und mit schräger Rückenlehne; oft mit Rohrgeflecht bespannt, aber auch mit Polsterung vorkommend; in England im 17.Jh. sehr verbreitet.
Delfter Fayencen: Blütezeit zw. 1650 und 1750; Herstellung von zinnglasiertem Steingut; technisches und künstlerisches Vorbild für die europ. Keramikerzeugung; anfangs direkte Nachahmungen chin. Porzellans, um die Mitte des 17.Jhs. Entwicklung zum eigenen Delfter Stil, wobei sich niederländische Elemente mit fernöstlichen verbanden und immer mehr zeitgenössische Malerei betrieben wurde; Erzeugnisse waren: Teller, Krüge, Milchgefäße, Blumentöpfe, Fliesen, Kacheln und allegorische Figuren mit biblischen Themen, Meeresblicken, Vogelmotiven u.a., meist Blaumalerei auf hellem Grund.
Directoire: * Klassizismus.
Docke: Altdt. Bezeichnung für Puppe; auch Bez. für * Baluster.
Draperie: Künstlerisch gefaltete Stoffe oder Vorhänge auf Bildern; auch in der Bemalung von Bauernmöbeln verwendet.
Drechseln: Sehr alte Technik der Formgebung von Holz und anderen Nichtmetallen, bei der das Werkstück auf einer Drehmaschine (Drechselbank) in Rotation versetzt und mit meist von Hand geführten Drehmeißeln bearbeitet wird; auf diese Weise entstehen Säulen, * Baluster, Knäufe und Kugeln, sowie die reich gegliederten ornamentierten Stäbe für die "gedrechselten Stühle" und Treppenaufgänge.
Dressoir: (Vom frz. dresser = anrichten); Form des * Stollenschranks der * Spätgotik und der Frührenaissance; später entwickelte sich daraus die * Anrichte, Kredenz oder Buffet.
Duchesse: * Chaiselongue des 18.Jhs.; Ruhesitz bestehend aus einer * Bergere und einem Fußschemel (Tabouret).
Dumb Waiter: ("Stummer Diener"); im 18.Jh. in Europa aufgekommenes zwei oder dreistöckiges Tischchen, meist mit Dreifuß, das zur Aufnahme von Tellern und Bestecken oder Speisen und Getränken diente; die an einer Mittelstütze angebrachten, nach oben kleiner werdenden Platten, sind drehbar.
Durlacher Fayence: 1722 von Johann Heinrich Wachenfeld gegr. Fayencemanufaktur; Ende 18. und Anfang 19.Jh. Erzeugnisse von höchster Qualität; vor allem kleine birnenförmige Gefäße (sog. Birnkrüge) sowie Kaffeekannen, mit bäuerlichen Figuren bemalt und mit einer Widmung und den Initialen des Empfängers (in schwarzen Buchstaben) versehen; die seit 1818 hergestellten Steinprodukte wurden mit der Marke Durlach (eingepresst) versehen.
Ebenholz: Sammelbegriff für verschiedene, dunkle, schwere u. harte exotische Hölzer; aufgrund ihrer hohen Polierfähigkeit gern für Prunkmöbel des 16. und 17.Jhs. verwendet.
E
Ebenist: Seit dem 17.Jhs. Bz. für einen Kunstschreiner, der urspr. nur mit Ebenholz, feine Einlegearbeiten an Möbeln herstellte; * Menuisier.
Ebonisiert: Schwarz gebeizt; * Ebenholz vortäuschend.
Eckschrank: * Encoignure.
Eckstuhl: Schreibtischstuhl des 18.Jhs. mit über Eck gestelltem Sitz und geschwungener Lehne, die zu Armen verlängert ist.
Egerer Kabinett: Mitte 17.Jh. in Eger (Böhmen) aus * Ebenholz gefertigtes Kabinettschränkchen (* Kabinett); außen und innen durch Figurenreliefs aus verschiedenfarbigen Hölzern geschmückt, von * Flammleisten gerahmt.
Eierstab: Aus der Antike stammende Schmuckleiste, in der senkrecht stehende Ovale mit pfeilspitzartigen Ornamenten abwechselnd angeordnet sind.
Einlegearbeiten: * Intarsien.
Eisenbeschläge: * Beschläge.
Emaille: Auf Metall aufgeschmolzenes farbiges Glas.
Empire: Bz. für eine Stilrichtung des * Klassizismus; zur Zeit Kaiser Napoleons I. (1804 15) in Frankreich entstanden u. im Kunstgewerbe, der Innenarchitektur und Mode vorherrschend bis nach 1830 in Europa; charakteristisch sind geradlinigflächige Formen mit antikisierendem symmetrischen Dekor; Hauptmotive: Säulen, Urnen, Kronen mit der Initiale N (= Napoleon), Girlanden, Lorbeer, Palmetten, Lyren, Dreizack, Chimären, Löwen, Schwäne und Sphingen; die Möbel sind häufig aus * Eben , Ulmen oder Ahornholz, hauptsächlich aber aus * Mahagoni hergestellt und mit kunstvollen, oft gegossenen Bronzebeschlägen dekoriert.
Encoignure: Einer Raumecke angepasstes, frei stehendes Schränkchen des 18.Jahrhunderts, mit ein oder zwei massiven bisweilen auch verglasten Türen; oftmals paarweise für einen Raum angefertigt.
Epoche: (Griech. epoche=Anhalten) Zeitwende, Zeitraum; in der Geschichte gewöhnlich Bz. für einen durch ein bes. Ereignis oder eine Person charakterisierter Zeitraum; urspr. der Zeitpunkt dieses „epochemachenden“ Ereignisses selbst.
Erkerschrank: * Stollenschrank
Espagnolette: Weiblich Büste spanischen Typs; als Dekoration an Stützen von Möbeln, bes. häufig auf frz. Möbeln des 18.Jhs., angebracht
Etagere: Im 18. Jh. entstandenes tragbares Gestell mit verschiedenen offenen Fächern, um kleine Gegenstände aufzunehmen; manchmal mit flachen Schubladen; war bes. im 19. Jh. beliebt.
Expressionismus: (lat.= Ausdruckssystem) eine Stilrichtung in der Bildenden Kunst, im wesentlichen von der Malerei getragen und bes. in Deutschland im 1. Drittel des 20. Jhs. verbreitet; steht mehr begrifflich und polemisch als entwicklungsgeschichtlich im Gegensatz zum Impressionismus, der schon die Tradition der perspektivischen Sicht aufgab, der Farbe die Vorherrschaft einräumte und die Maltechnik vereinfachte. Cézanne, Gauguin, van Gogh und der europ. * Jugendstil mit Hodler und Munch, die sich der Ausdruckskraft rhythmischer Linien und reiner Farben in flächigen Kompositionen bedienten, waren Wegbereiter des E. Der E. beabsichtigte statt des Natureindrucks den Wesensausdruck, das des Abbildes das Sinnbild. Es geht im E. nicht mehr um den Darstellungswert der Dinge, sondern um ihren Ausdruckswert; damit wurde ihre objektive Gestalt der Willkür der Künstler ausgeliefert. Sie erkannten den Eigenwert absoluter Formen und Farben, d. h. die Möglichkeit einer gegenstandslosen Malerei. Durch den E. wurde die Kunst der Primitiven „entdeckt“, sowohl die der Neger als auch die des frühen MA; ebenso wurde die Farbeglut Grünewalds und die Ekstatik Grecos wie überhaupt der Manierismus modern. Der E. erhielt durch die Erschütterung des 1. Weltkriegs als geistige Bewegung neuen Auftrieb, auch in der Literatur und in der Musik.
F
Fadeneinlagen: * Linieneinlagen
Fälscher: * Kunstfälscher
Faltstuhl: Zusammenklappbarer * Hocker mit x förmigem Gestell und einem Sitz aus Gurten oder Leder; bereits im Altertum gebräuchlich und verbreitet, in Rom Sitz der Konsuln und Prätoren (Faldistorium, lat., davon abgeleitet das französische Fauteuil), im Mittelalter repräsentativer Sitz für geistliche und weltliche Würdenträger.
Faltwerk: * Ornament an (bes. niederländischen) Möbeln der * Spätgotik; aus senkrecht stehenden, eng gereihten Falten, die aus dem Holz durch Hobel und Schnitzmesser herausgearbeitet wurden; dabei entstand der Eindruck gefalteten Pergaments.
Faltstern: Sternförmige Einlage in der Möbelkunst; wirkt aufgrund von Hell Dunkel Kontrasten plastisch.
Farbglas: In der Glasmasse gefärbtes Glas, um bewusste Farbwirkungen zu erzielen; bereits ägyptische Glasmacher stellten feine Farben her, urspr. mit farbigen Steinen (Malachit und Lapislazuli für Grün und Blau), später mit Metalloxiden (Kupfer für Grün und Blau, Eisen für Grün und Gelb, Kobalt für Dunkel und Hellblau, Mangan für Purpur); von der Antike bis ins frühe 19.Jh. kaum Änderung der Farbskala (Ausnahme: rubinrotes böhmisches Glas im späten 17.Jh.)
Fassadenschrank: Zweigeschossiger, ausgeprägt architektonisch gestalteter * Schrank, nach Vorbild der Steinarchitektur; hauptsächlich in der * Renaissance und im * Frühbarock in Süddeutschland verbreitet, meist viertürig, von Säulen und * Pilastern eingefasst; zum Typ des Fassadenschrankes gehören der * Augsburger, der * Nürnberger und der * Ulmer Schrank.
Fassmaler: Meister, der eine Holzplastik fasste, d.h. bemalte und vergoldete; meist nicht identisch mit dem Bildschnitzer.
Fassonieren: Einkerben von Rändern bei Geschirr aus * Porzellan, * Silber oder * Zinn.
Fassung: Vergoldung und Bemalung von Plastiken (* Fassmaler); Befestigung eines Edelsteins auf einem Schmuckstück; Edelmetallbeschläge an Gefäßen und Geräten aus anderem Material, wie Stein, Holz, Elfenbein etc.; diese Fassung nennt man auch Montierung; ebenso Metallbeschläge an Möbeln.
Faun: Römischer Schutzgott für Vieh und Felder, als Mensch mit tierischem Unterleib, Bocksfüßen und Hörnern dargestellt.
Fauteuil: Frz. Armstuhl des 17. und 18. Jhs, dessen Sitz, Rückenlehne und Armlehnen gepolstert sind.
Fauteuil de bureau: * Eckstuhl.
Fayence: Von der ital. Stadt Faenza abgeleitete frz. Bz. für Tonware mit porösem Scherben, mit weißer undurchsichtiger oder farbiger Zinnoxydglasur überzogen, meist mit Scharffeuer oder Muffelfarben dekoriert und mehrmals gebrannt.
Fenstersofa: (Engl. window-stool); Sofa ohne Rückenlehne u. mit schrägen Armlehnen; Form einer Fensternische angepasst.
Feston: Girlande; Laub , Blumen , oder Fruchtgehänge und gewinde; oft von Bändern umwunden, deren Enden herabflattern; bevorzugtes Schmuckmotiv klassizistischer Epochen wie * Louis-Seize und * Empire.
Festungsfüllungen (Festungsstil): * Bastionsfüllungen.
Fichtenholz: Langfaseriges Nadelweichholz; nur für Bauernmöbel, oft als * Blindholz, für Innenteile wie Schubladen u.ä. verwendet oder als Furnierträger des ganzen Möbelstückes.
Filet: Gegeneinander gestellte helle und dunkle Furnierflächen.
Flachschnitt: Reliefverzierung spätgotischer Nadelholzmöbel in Süddeutschland und den Alpenländern; das florale Ornament aus Bändern, Ranken, Pflanzen und geometrischen Mustern wurde mit dem Schnitzeisen (Geißfuß) ausgestochen und mit dem Meisel ausgesprengt, manchmal bemalt.
Flammleiste: Wellige, profilierte Rahmenzierleiste; vor allem bei Ebenholzmöbeln zur Einfassung der * Füllungen im 17. und 18.Jh. verwendet; angeblich von dem Nürnberger Hans Schwanhard im 16.Jh. erfunden.
Flirting Eyes oder Schelmenaugen: In Puppenköpfe eingesetzte, sich seitlich hin und her bewegende Glasaugen, ab ca. 1890 in Verwendung.
Formalismus: Kunstanschauung, die das rein Formale (Form, Ausführung im Gegensatz zu Ausdruck und Inhalt) überbetont.
Frankenthaler Porzellan: Porzellanmanufaktur, 1755 durch Paul Hannong in Frankenthal bei Mannheim gegr.; 1799 nach mehreren Verkäufen aufgelöst; die Geschirre zeichnen sich durch vorzügliche Malerei aus; zahlreiche Figurenmodelle.
Frankfurter Fayence: Fayencemanufaktur, 1666 von Johann Simonet gegr.; 1772 geschl.; Herstellung von Wein und Trinkkrügen, große Vasen und Schaugefäße; Anlehnung an * Delft.
Frankfurter Schrank: Bezeichnung für einen zweitürigen Schranktyp des * Barock; vor allem in Frankfurt a.M. beheimatet; hoher Sockel, meist auf sechs Kugelfüßen ruhend; das stark ausladende Gesims ist mehrfach gestuft, gerade oder gekröpft; durch * Säulen und * Pilastern betonte Vertikale; die * Füllungen sind durch Hohlstäbe und Rundstäbe (Wellenschrank) großzügig gegliedert; zuweilen sind die Eckstützen zu kräftig vorspringenden Wülsten ("Nasen") geworden; diese Sonderform heißt Nasenschrank..
Fries: Waagerecht verlaufendes Feld oder Flächenstreifen, in der Architektur als Abschluss oder zur Gliederung einer Wand; meist mit plastischen, in Innenräumen vielfach gemalten Ornamenten und Figuren; im Kunsthandwerk als Zierart an Möbeln, Metallarbeiten, Keramik u.ä.
Friesische Fayence: * Delft.
Frisiertisch: Tisch mit Schubladen, dessen Platte mit einem eingebauten Drehspiegel (* Psyche) ausgestattet ist; er übernahm im * Empire die Funktion, die im * Rokoko der * Toilettentisch innehatte.
Füllungen: Dünne Bretter, mittels einer Nut in einen Rahmen eingepasst, so daß sie "* arbeiten" können, ohne zu reißen.
Fuldaer Fayence: Fayencemanufaktur, 1741 von Amandus von Buseck gegr.; trotz kurzen Bestehens (bis 1758) gehört sie zu den besten in Deutschland; der harte Scherben eignete sich für Stand und Wandleuchter, Vasen und andere schwer herstellbare Formen (bunte Malerei in Scharffeuer und Muffelfarben; charakteristisch sind grossformige Blumen, die besten Stücke sind die von Adam Friedrich von Löwenfinck bemalten Vasen); die Marke der Manufaktur war FD.
Fuldaer Porzellan: Manufaktur (1765 1790); von Fürstbischof H. von Bibra gegr.; zeichnete sich durch vorzügliche Malerei der Geschirre und feine Bemalung der Figuren aus; Anlehnung an * Frankenthaler Manufaktur; als Marke wurde anfangs ein Kreuz, ab 1780 ein doppeltes F mit Krone in Unterglasurblau verwendet.
Funktionalismus: Der moderne F. in Architektur und Kunstgewerbe fordert die Einheit von Aufgabe und Gestalt, d.h., die neuen technisch konstruktiven Errungenschaften sollen auch im ästhetischen Bereich neue Möglichkeiten eröffnen. Für funktionell gestaltete Möbel ergibt sich daraus als Grundsatz, daß sie zweckentsprechend schön zugleich sein müssen. Wegbereiter dieser keineswegs immer selbstverständlichen Gedanken war der Engländer William Morris u. mit ihm die "Arts and Crafts-Bewegung". Im gleichen Sinne arbeiten die "Chicagoer Schule", die holl. Gruppe "De Stijl" u. das "Bauhaus", ehe diese Ideen bestimmend für die "Moderne" wurden.
Furnierung: Durch Sägen, Schneiden oder Schälen hergestellte dünne Edelholzbretter (Furniere), die auf geringwertige Hölzer (* Blindhölzer) aufgeklebt und poliert werden; in der * Renaissance aufkommend.
G
Galle, Emile: (1846 1904); aus Nancy stammender Kunstgewerbler, der neben den weltberühmten "Galle Gläsern" auch Möbel gefertigt hat; seine signierten Erzeugnisse sind charakteristische * Jugendstilschöpfungen.
Gateleg-Tisch: Klapptisch mit runder oder viereckiger Platte und herausschwenkbaren Beinen, die an ein Tor (gare) erinnern; in England im 17Jahrhundert. entstanden und meist als Esstisch in Gebrauch.
Gefrorene Charlotten oder Frozen Charlottes: Biskuit oder Porzellanpuppen aus einem Stück, benannt nach einer um 1830 beliebten Moritatenheldin aus Amerika, die aus Eitelkeit in einer Nacht erfror; um 1850 bis 1914 in Mode.
Gehrung: Auf Gehrung geschnitten nennt man die Verbindung zweier im rechten Winkel aneinanderstoßender Bretter oder Leisten, die in einem Winkel von 45 Grad abgeschnitten sind.
Geißfuß: 1. (Frz. pied de biche = Rehbein); Möbelfüße des * Rokoko, oft in einem deutlichen Huf endend; Anfang 18.Jh. ersetzte er an Stühlen den schweren Balusterfuß des * Louis-Seize-Stils; 2. in der Schreinerei gebräuchliches Stechwerkzeug mit winkeliger Schneide zum Ausheben von Fugen.
Georgismus: Spezielle Metalleinlegetechnik auf engstem Raum, wird besonders angewendet bei Weichholzkörpern, Gesimsen und Profilleisten. * Gorghini.
Gesims: Waagrechter, ausladender, meist profilierter Streifen in der Möbelkunst (Architektur), der horizontal aufgliedert.
Giebel: Dachabschluss eines Möbels.
Giebelschrank: Auf antike Vorbilder zurückgehender mittelalterlicher Schrank mit spitzem Giebel und einer schmalen Tür oder zwei übereinander angeordneten Türen.
Girlande: * Feston.
Globustischchen: Nähtischchen in Globusform, aufgekommen in der * Biedermeierzeit.
Gobelins: In Deutschland gebräuchlicher Name für handgewirkte Bildteppiche; im engeren Sinn Bz. für die Erzeugnisse der frz. Manufacture des Gobelins.
Golliwog: Maskottchenartige Puppe nach einer Kinderbuchfigur von Florence Upton, 1895 patentiert.
Gotik: Stilepoche der europ. Kunst, die regional verschieden von vor 1200 bis nach 1500 dauerte; um 1140 wurde in der Ile de France in Nordfrankreich der gotische Stil geschaffen (Frühgotik); um 1190 setzte mit dem Bau der drei klassischen gotischen Kathedralen Chartres, Reims und Amiens die Hochgotik ein; in Deutschland begann die Frühgotik um 1235, als Hochgotik bezeichnet man die Zeit von 1270 bis 1360; um 1360 etwa rechnet man den Beginn der europ. * Spätgotik. Die beherrschende Kunstgattung der Gotik war die Architektur, sie setzte mit ihren in den Himmel strebenden Kathedralen Maßstäbe, die auch im profanen Bereich entscheidenden Einfluß ausübten; die charakteristische Einzelform war der Spitzbogen; er fand auch in der Möbelkunst seine Verwendung (gotische Truhe, spätgotischer Stollenschrank)
Gorghini: Künstlername von Donzberger, Georg; bekannter Restaurator der Neuzeit im Heilbronner Raum, Begründer des * Georgismus.
Graphikschrank: * Kartenschrank.
Gravur: Aufbringen von Zeichnung und Schrift auf harte Oberflächen, wie Metall, Glas, Elfenbein, Horn, Stein usw. Wird meist mit Hilfe von Graviernadeln, Meißel, Stichel oder Punz Werkzeugen ausgeführt. Seit dem 16. Jh. sind Vorlagenbücher mit Ornamentstichen bekannt, sie dienten den Gold und Silberschmieden als Gravurvorlage oder als Anregung. Die Gravur ist wohl die älteste Technik der Metallverzierung.
Gros point: (Frz. "Großer Stich"); einfacher Kreuzstich; seit dem 16.Jh. in der Stickerei üblich; im 17. und 18.Jh. wurde er für Möbelbezüge, Decken und Wandbehänge verwendet.
Groteske: Antikes Ornamentenmotiv, in der * Renaissance wieder aufgenommen; aus der * Arabeske entwickelt, tritt das Rankenwerk zurück, dafür werden Figuren, Tiere und Fabelwesen hinzugefügt; um 1700 kam die Groteske wieder in Mode.
Gueridon: Nach einem schwarzen Galeerensklaven benanntes hohes, rundes Tischchen in Form eines tablettragenden Negers zum Abstellen von Nippessachen oder einer Kerze; seit dem 17.Jh. zur luxuriösen Wohnungseinrichtung gehörend.
Gustavianischer Stil: Schwedisches Louis-Seize.
H
Hafnerkeramik: Sammelbz. für Tonware mit einem Überzug aus farbiger Bleiglasur; für Gebrauchsgeschirr, hauptsächlich aber für Ofenkacheln verwendet. Im MA bes. in Deutschland, Österreich und der Schweiz hergestellt; Exponate aus dem 15.Jh. zeigen Reliefdekor und grüne, gegen Ende des Jhs. auch gelbe und braune Bleiglasur; die Blütezeit lag im 16.Jh.; die Zentren waren Nürnberg, Köln, Schlesien, Sachsen u. Salzburg.
Halbsäule, Dreiviertelsäule: Nur halb bzw. dreiviertel aus der Wand oder einem Möbelstück hervortretende Säule, unterstreicht oft die architektonische Gliederung eines Möbels.
Hamburger Schapp: (Hamburger Schrank); großer zweitüriger Dielenschrank des * Barock, meist in Nussbaum furniert, mit geradem, verkröpftem Gesims, Schubladengeschoß und abgeflachten Kugelfüßen; Türen von * Pilastern eingerahmt, die * Füllungen meist spitzoval; Pilaster, Zwickel der Türfelder und Mitte des Abschlussgesims mit reichem Schnitzwerk versehen.
Hanauer Fayence: Erste dt. Fayencemanufaktur, 1661 von zwei Holländern in Hessen gegr.; war bis 1806 in Betrieb und wechselte häufig den Besitzer; Erzeugnisse waren u.a. Engelhals und Birnbaumkrüge, Vasen, Teller und mancherlei Geschirr für den bürgerlichen Haushalt; anfangs starke Anlehnung an * Delfter Ware mit Bemalung in chin. Stil, dann zunehmend europ. Motive: Wappen, Zunftembleme, Landschaften und biblische Szenen in Verwendung von Scharffeuerfarben und um 1750 Emailfarben; seit 1797 Herstellung von cremefarbenem Steingut; Marken: Mondsichel, HVA und Hanau.
Hansekannen: Nordd. Zinnkannen des 14. und 15.Jhs.; gebauchte Deckelkrüge mit abgesetztem Fuß, zum Körper des Gefäßes gehörend, das bis unten hin Flüssigkeit aufnimmt; die Wandung ist glatt; der Rücken des lang herabgezogenen Henkels zeigt reliefierte Ranken oder Jagdmotive; im Deckel sind meist Plaketten mit biblischen Darstellungen eingelassen.
Hepplewhite, George: (gest. 1786); Londoner Kunstschreiner u. Entwerfer; schuf bes. Sitzmöbel in vereinfachter, eleganter u. leichter Abwandlung des * Louis-Seize; das posthum erschienene Vorlagenwerk "The Cabinet-Maker’s and Upholsterer's Guide" (1788, 1789 und 1794) beeinfl. die europ. Möbelkunst.
Herme: Tragende Halbfigur oder Büste mit Pfeilersockel; seit der griechischen Antike in der Architektur und im Kunstgewerbe gebräuchlich.
Hinterglasmalerei: Malerei (mit Deckfarben) auf der Hinterseite einer Glasscheibe; um auf der Vorderseite das richtige Bild zu ergeben, erfordert diese Technik die Umkehrung der Malfolge, z.B. zuerst das Setzen von Glanzlichtern, zurückgehend bis zum Hintergrund; künstlerischer und technischer Höhepunkt im 16.Jh. in Deutschland, Niederlande, Italien und Spanien (Andachts und Votivbilder).
Hirnholz (Querholz): Rechtwinklig zum Faserlauf geschnittenes Holz, die Jahresringe sind bei diesem Schnitt sichtbar.
Historismus: Die Nachahmung historischer Stile, die die zweite Hälfte des 19.Jhs. beherrschte; beginnend mit der Nachahmung des * Rokoko im frz. Stil * Louis Philippe und der * Gotik, die in England seit 1750 auftrat und in den 40er Jahren des 19.Jhs. in Europa üblich wurde, ist die zweite Jahrhunderthälfte durch die Nachahmung der * Renaissance und des * Barock gekennzeichnet; am Ende des Jhs. wurde der Historismus durch den * Jugendstil überwunden.
Hochbarock: * Barockstil.
Hochzeitstruhe: * Brauttruhe.
Hocker (Schemel): Eines der ältesten europäischen Sitzmöbel mit niedrigerem Sitz wie bei anderen Sitzmöbeln, ohne Rückenlehne, mit drei oder vier Standbeinen.
Höchster Fayence und Porzellan: Im Jahre 1746 von den Frankfurter Kaufleuten Göltz und Clarus zusammen mit A. F. von Löwenfinck gegr. Manufaktur, die anfangs offenbar nur Fayence erzeugte (bis 1758 reiche Formen modellierten Geschirrs mit Muffelmalerei tragenden Motiven von Tieren und Pflanzen); Herstellung von Porzellan nach 1750 (übliche Geschirrformen der Zeit mit im Dekor überwiegender Purpurmalerei); Marke: Fayence und Porzellanmanufaktur, das sechsspeichige Rad des kurmainzischen Wappens, zuweilen in Verbindung mit diversen Malersignaturen.
Höroldt, Johann Gregorius (1696 1775): * Meißen.
Hohenloher Tresur: Niedriger, zweitüriger Schrank, zum Teil auf zwei gedrechselten Pfosten mit Bodenbrett ruhend und mit einem Stufenpodest als Abschluss gestaltet; als vergleichbare Möbel können * Kredenz, * Anrichte, * Buffet, im höfischen Bereich der * Kabinettschrank angesehen werden; fernes Vorbild ist wohl das als * "Dressoir" bekannte gotische Möbel.
Hollandpuppen oder Flandern Babies oder Dutch Dolls: Ursprünglich im Grödnertal gefertigte Holzpuppen; massenweise nach England exportiert. Kleinere Puppen meist mit Dübelgelenken, große auch mit Kugelgelenken; typisch: schwarze aufgemalte Haare.
Huffuß: * Geißfuß.
Humpen: Zylindrisches, walzenförmiges oder kegelstumpfartiges Trinkgefäß, meist außerordentlich volumenhaltig. Oft mit Scharnierdeckel, Daumenruhe und abgesetztem Fußring; viele verschiedenartige Ausführungen in der Verzierung, wie Bemalung , Gravuren, Medaillons, Reliefs; mit meist historischen, allegorischen od. biblischen Motiven. Hergestellt wird der Humpen häufig aus Silber, Zinn, Fayence, Glas oder Steingut.
Hund, Ferdinand: (Um 1704 1758); bedeutender fränkischer Kunstschreiner u. Holzbildhauer, ab 1735 in Würzburg, ab 1750 Hofschreiner in Bruchsal; schuf reichgeschnitzte Tische, Spiegelrahmen und Kaminschirme für die Schlösser Würzburg, Pommersfelden und Bruchsal, in denen er das Schmuckmotiv der * Rocaille bis an die Grenze der Auflösung trieb.
I
Ikonographie: Lehre von den Bildinhalten.
Indiscret: Dreisitziges gepolstertes Sofa, in der Form dreier s förmig miteinander verbundener * Bergeren; in der zweiten Hälfte des 19.Jhs. in Frankreich sehr beliebt.
Inkrustation: Einlegearbeit aus Stein, wobei oft Marmor und Halbedelsteine verwendet wurden.
Intarsien: Einlegearbeiten aus verschiedenen auch gefärbten Hölzern, Metalle, Perlmutter, Schildpatt, Elfenbein in das Grundholz der Möbel, bes. in der Zeit der * Renaissance und des * Barock bis etwa 1800.
Irdenware: Bezeichnung für schwach gebrannte, recht offenporige Keramik. Später mit einer Glasur versehen wird die Irdenware wasserundurchlässig. Bekannt als Irdenware ist hauptsächlich die auch heute noch oft hergestellte Hafnerkeramik, wie auch das früher weit verbreitete und vielverwendete, bleiglasierte, einfache Bauerngeschirr.
J
Jacarandaholz: Südamerikanisches Holz von großer Härte und Dichte; sehr dunkel gefärbt, meist vorkommend als Palisanderholz aus Brasilien.
Jardiniere: Blumentisch mit eingesetzter Schale; vor allem im 19.Jh. sehr verbreitet.
J.M.F.'.: ("Juras Menuisiers Ebenists"); Kontrollstempel der Pariser Tischlerzunft; kommt auch als Zusatz der Pariser Ebenisten- Signaturen vor. * Ebenist.
Jugendstil: In Frankreich Art nouveau genannt; der von 1895-1905 herrschende Stil der europ. Kunst, der den * Historismus des 19.Jahrhunderts überwand und die Grundlagen der modernen Kunst schuf.
K
Kabinett: (Kunstschrank, frz. Cabinet d' Allemagne "deutsches Kabinett"); Prunkmöbel zum Aufbewahren von Kostbarkeiten oder Schreibsachen, im 16.Jh. entstanden; aus dem spätgotischen spanischen Vargueno hervorgegangen, Schreibschränkchen mit aufklappbarer, auf Stützen stehender Platte. Das K. des 17.Jhs. hatte einen tischartigen Unterbau aus Schränkchen oder Kommode bestehend; im Aufsatz viele Schubladen, die Vorderseite meist durch zwei Türen verschließbar; in Deutschland im 16.Jahrhundert vor allem in Augsburg hergestellt * Augsburger Kabinett.
Kaendler, Johann Joachim (1706 1775): * Meißen.
Kahnbett: Bett in Kahnform, das vorwiegend im * Empire in Gebrauch kam.
Kaliko: Baumwollgewebe, mit einer Appretur versehen; geeignet für Puppenkörper.
Kannelierung: (Kanneluren); senkrechte Vertiefungen in Rillenform an Säulen und Pfeilern; entweder scharfkantig aneinanderstoßend oder durch Stege getrennt; beliebte Verzierung in der antiken Architektur; später ins Kunsthandwerk übernommen und als Dekor an Möbeln, Metallarbeiten etc. verwendet.
Kapitell: (Lat. capitellum = Köpfchen); in der Baukunst oberer Abschluss von Säulen, Pfeilern oder Pilastern, ornamental skalpiert oder bei Möbeln auch nur in Form einer geschnitzten Auflage zur Dekoration verwendet.
Kartusche: Ornament des * Barock mit schildförmiger Mittelfläche, die von einem üppigen Roll und Schnitzwerk umgeben ist, wird häufig verwendet im Möbelbau.
Karyatide: Stützfigur in Frauengestalt anstelle einer Säule.
Kasseler Fayence und Porzellan: Von 1680 bis 1780 wurden in Kassel mit Unterbrechungen Fayencen hergestellt; die sehr seltenen hochwertigen Erzeugnisse bestehen aus Vasensätzen mit Blaumalerei; Anlehnung an * Delft; Marken: Der hessische Löwe, ligiertes HL, H und C. 1766 entstand aus der Fayencemanufaktur eine Porzellanmanufaktur, in der Gebrauchsgeschirre mit Blaumalerei und simple Figuren hergestellt wurden; Marke: Ein unterglasurblauer Löwe und das Monogramm H.C.
Kastensitz: Aus einem Kasten auf Füßen gebildetes Sitzmöbel mit und ohne aufgesetzten Arm und Rückenlehnen; seit dem 13.Jahrhundert mit Schnitzereien im Flach Relief geschmückt und blieb bis zur * Renaissance in Gebrauch; in Skandinavien sogar bis heute.
Kastentisch: Seit der * Gotik bekannte Tischform, bei der die Tischplatte auf einem rechteckigen Kasten liegt, der meist durch vorn angebrachte Türen oder durch Anheben der Platte zu öffnen ist; im 16. und 17.Jh. wurde der Kasten zuweilen auf. eine die Platte tragende Bogenstellung reduziert; bei einer weiteren Ausprägung des Typs, der als Schreib und Arbeitstisch diente, liegt unter der Platte ein flacher, mit einem Kranz kleiner Schubfächer versehener Kasten, der auf seitlichen Stützbrettern oder Wangen sitzt und daher Wangentisch genannt wird; im 15. und 16.Jh. war der Kastentisch hauptsächlich in den Alpenländern und in Süddeutschland verbreitet, kam aber auch im Rheinland, in Mittel und Norddeutschland vor; lebt im bäuerlichen Bereich als sog. Rhöntisch bis ins 18.Jh. fort.
Kauritz: * Zylinderbureau.
Kehlarg: Rillenartige Vertiefung, vor allem bei Leisten, Profilen und Rahmen.
Kelim: (Kilim, Gelem, Gilim, Ghilim), ein Wirkteppich mit leinwandbindigem Schuss, der außer im Orient auch in Südosteuropa hergestellt wird. Der farbige Schußfaden wird so lange durch die Kette hin und her gezogen, bis ein neuer Musterteil beginnt. Da der Schuß nie über die ganze Breite des Teppiches führt, entstehen an den Kreuzungsstellen zw. Schuß und Kettfadengruppe charakteristische Schlitze. Die meist geometrische Musterung ist beidseitig gleich. Zu den Kelimarten gehört auch der "Sumak", der im Unterschied zum Kelim auf der Rückseite voll langer Abrissfäden ist und dessen reliefartige Wirkung auf der Verwendung verschiedener Garnstärken beruht. Bes. reizvoll sind die anatolischen, oft mit Silberfäden durchzogenen Kis-Kelims und die von Kurden gewebten persischen Senneh-Kelims.
Keramik: Bezeichnet die Töpferkunst sowie die von ihr geschaffenen Werke aus gebranntem Ton (* Fayence, * Hafnerkeramik, * Majolika, * Porzellan).
Kewpies: Nach Rose O'Neills Zeichnungen zu Kindergeschichten in einem Damenjournal 1913 patentierte Puppe.
Kieler Fayence: 1763 von Herzog von Holstein gegr. Fayencemanufaktur; 1788 geschlossen; unter der Leitung von Johann Buchwald (ab 1769) wurde sie zur bedeutendsten Manufaktur Norddeutschlands; vielgestaltige Produktion (Tischplatten, Rokokoterrinen, Potpourrivasen); strahlend weiße Glasur; oft sind Blumen und Früchte plastisch aufgelegt; die Marke bestand aus drei übereinander angeordneten Buchstaben.
Kirschbaum: Bräunlich bis rotbraunes, hartes Holz mit schöner Maserung und warmem Farbton; in der * Biedermeierzeit gerne für Furniere (* Furnierung) verwendet, wird meist für hochwertige Möbel verarbeitet; lässt sich bei der Oberflächenbehandlung sehr gut polieren.
Klapperdocken oder Rasseldocken: Gedrechselte Holzpuppen aus Sonneberg mit Erbsen oder Steinen im hohlen Körper.
Klappsekretär: * Secretaire en armoire.
Klassizismus: Allg. alle der klassischen Antike nachempfundenen Kunstbestrebungen; insbesondere aber antikisierende Kunstströmungen, die erstmals um 1560 in Italien einsetzten und im 17. Jahrhundert, vor allem aber im späten 18.Jahrhundert besonders in Frankreich und England anzutreffen sind. Im engeren Sinn umfasst der Klassizismus die Zeit von etwa 1790 bis 1820; die Frühphase vor 1800 wird in Frankreich * Directoire genannt; die folgenden zwei Jahrzehnte werden allgemein nach dem napoleonischen Kaiserreich als * Empire bezeichnet.
Kneehole Desk: Kleiner englischer Schreibtisch, der in der Mitte eine Aussparung für die Knie hat und mit einer Rückwand versehen ist.
Knopfheftung/ Knopfraffung: Dekorative Polsterung; im 19.Jahrhundert entwickelt.
Knorpelstil: (Knorpelwerk); Ohrmuschelomament des Frühbarock; kurvig bewegte, verknorpelte, wulstartige Gebilde und maskenhafte Elemente (Ohrmuschelstil); entstand um 1600.
Kölner Intarsienmöbel: In Köln wurden um 1600 Eichenmöbel reich mit * Intarsien in der südd. Art geschmückt (Architekturbilder, Wappen, Vasen mit Blütenranken u. a.)
Koffertruhe: Truhe mit gewölbtem Deckel; an alte Reisetruhen bzw. Reisekoffer erinnernd; vor allem im frühen 18.Jahrhundert beliebtes Möbelstück.
Kolonialstil: Nachklassizistischer, das Klima und die Eigenarten des Landes berücksichtigender Stil des 19.Jhs. in engl. Kolonien und in Nordamerika.
Kolorismus: (Von lat. color = Farbe); Betonung der Farbe in der Malerei.
Kommode: Aus der Truhe entwickeltes, halbhohes Kastenmöbel mit zwei bis vier Schubladen; im * Barock und * Rokoko sehr beliebt.
Kompositenkapitell: Aus mehreren Schnitzornamenten zusammengesetztes * Kapitell (* Säule).
Konsoltisch: Architektonisch durchgebildeter Wandtisch, oft mit Trägern anstelle von Beinen an der Wand befestigt; auch als Klapptisch; meist halbrund oder rechteckig; häufig mit einer Marmorplatte und dazu passendem Spiegel, oft reiche Verzierungen (u. a. Stuckarbeiten) im 17.Jahrhundert aufgekommen.
Korinthische Säule: Sie trägt ein Akanthusblatt Kapitell, an dessen vier Ecken kleine diagonalstehende * Voluten auskragen (* Akanthus und Säule).
Korpus: Der strukturelle Körper des furnierten Möbels.
Kredenz: * Anrichte.
Kreuzfugenfurnier: Vier jeweils gegeneinander abgesetzte Furnierblätter.
Kröpfen: Scharfwinkliges Umbrechen, auch Absetzen von Simsen und Leisten; bes. um Pfeiler und bei Fenstergiebeln.
Kürbiskopf: Wachsköpfe mit anmodelliertem Haar um 1840 bis 1860 in Mode; auch Papiermacheköpfe mit Wachsüberzug.
Kubismus: (Von lat. eubus = Würfel), künstlerische Gestaltungsform, die in der Malerei Frankreichs um 1910 durch Braque und Picasso (auch Plastiken), Delaunay und Leger entwickelt wurde. Durch den konzentrierten Bildorganismus Cezannes und sein Zitat: "Man behandle die Natur gemäß Zylinder, Kugel und Kegel", vorbereitet, bricht der Kubismus Bahn für die schon im Impressionismus einsetzende Entmaterialisierung der Bildgegenstände, die (in Teile gebrochen, gekantet oder gewinkelt) die Dynamik reiner Formkräfte in der Bildstruktur aufzeigen. Dieser sog. analyt. Kubismus ermög¬licht durch Formzerlegung die Durchdringung von Körpern und die Gleichzeitigkeit verschiedener Ansichten; als folgerichtige Flächenkonstruktion führt er zum Konstruktivismus. Aussichtsreicher erwies sich die Kombination mit dinglichen Darstellungen im synthet. Kubismus, wo er auch internationale Nachfolge fand (Marc, Klee, Feininger, Chagall; die Futuristen). Als gesamtkünstlerisches Phänomen wirkte der Kubismus auch auf Bildhauer (Laurens, Lipschitz, Belling, Scharf und Architekten, bes. die des Bauhauses (W.Gropius).
Kufen: Auf dem Boden aufliegende kufenartige Hölzer, die als Möbelfüße von schweren Schränken und Truhen für gute Standfestigkeit sorgen.
Kunst: Im allg. Sinn (abgeleitet von "Können") jede sicher beherrschte Fertigkeit (z.B. Koch Kunst); im engeren Sinn jedes Kunstwerk; im engsten Sinne: Architektur, bildhafte Kunst, Ornament, Kunstgewerbe. Wesen: Die Kunst ist eines der großen Sachgebiete in der selbstgeschaffenen Welt des Menschen zusammen mit Wirtschaft, Recht, Staat, Wissen¬schaft, Kultformen; der Mensch schafft sich diese Welt zur Ordnung, Erhellung und Erhöhung seines Daseins. Alle Kunst verwirklicht sich in Gebilden, die an eine bestimmte Materie gebunden sind ( z.B. an Stein oder Holz, Töne oder Sprachlaute, die Stimme des Sängers oder den Leib eines Tänzers). Dabei kommt es nie auf die Materie an sich, sondern auf ihre Rolle im Ganzen des Werkes an: sie hat keinen Eigen , sondern einen Funktionswert. Die Gebilde der Kunst sind konkret: sinnliche, geschichtsgesättigte Erscheinung, also niemals Begriff oder Idee. Aus der Konkretheit des Werkes folgt seine Einmaligkeit: es ist atypisch und unwiederholbar, ist nur es selbst. Einmalig wird es dadurch, daß der Künstler es mit seinem persönlichen Sein durchtränkt (so sehr, daß wir etwa von einem Bilde Rembrandts sagen, es sei ein Rembrandt). Aber diese geschichtliche und persönliche Einmaligkeit des Werkes zielt nie auf die Mitteilung nur zeitgebundener oder rein persönlicher Empfindungen. Vielmehr erreicht es auf diesem Wege gerade eine überindividuelle Bedeutung, die es für jeden Menschen wichtig macht. Der Künstler hat die Gabe, am konkret Einzelnen und durch sein persönliches Erleben den Grund des Daseins spürbar zu machen.
Kunstfälschung: Jedes Kunsterzeugnis, das von seinem Verfertiget zum Zweck der öffentlichen Irreführung oder der eigenen materiellen Bereicherung für das Werk eines anderen Urhebers ausgegeben wird. Dabei gibt es eine Unterscheidung zur Kopie eines Kunstwerkes. Bei der Kopie, meist in der bildenden Kunst oder der Malerei vorkommend, bedient sich der Fälscher besonderer Eigenheiten oder stilistischer Merkmale eines anderen Künstlers und versieht das so geschaffene Werk mit gefälschten Echtheitsbeweisen. Der Umfang der Fälschertätigkeit richtet sich meist nach dem Marktwert und nach den Absatzmöglichkeiten originaler Werke, außerdem nach der Schwierigkeit, ein Werk zu fälschen.
Kunstfälscher: Lämmle, Wolfgang; geb. am 11.06.1941 in Stuttgart Bad Cannstatt, im Frühjahr 1988 als einer der größten Kunstfälscher der 80erJahre entlarvt, fälschte Werke bedeutender Künstler der letzten drei Jahrhunderte:
"Hab' nachgedacht und nicht gelacht, denn auf Zeiten einer ungestörten Kunstentwicklung folgt der natürliche Vorstellungstrieb den gesetzmäßigen Bahnen unserer Organisation, und der Künstler wird sich dieser natürlichen Gesetzmäßigkeit nur insofern bewusst, als er es für selbstverständlich hält, logisch zu sein und dem natürlichen Trieb Ausdruck zu geben. Meine Kunst sie steht in einem geistigen Bann darin denke und fühle und lebe ich eingebettet im künstlerischen Naturgesetz.
Zwischen Vorstellung und Wahrnehmung besteht noch keine Kluft, ich nehme mit der Vorstellung wahr und eine Wahrnehmung aus anderen Gesichtspunkten ist mir noch nicht bekannt. Wie in meiner Kindheit wird die Wahrnehmung unmittelbar zur Vorstellung. Alle anderen Zeiten gerade die heutigen sind deshalb für mich und überhaupt unkünstlerisch, weil wenn jemand in einem Bann lebt und ich glaube, daß es gut ist, so wird etwas zerstört, ungestört und falsche Interessen und Gesichtspunkte beirren den natürlichen künstlerischen Trieb. Man lenkt sich aus der Bahn, wenn man dabei bedenkt, daß die künstlerische Vorstellung im Grunde nichts weiter ist, als eine natürliche Weiterentwicklung der Vorstellungsarbeit, die wie ich glaube, jeder Mensch schon in seiner Kindheit vollzieht, und gerade die Kindheit ist es, wo die Fantasie und das Augenerleben am lebendigsten sind, so lässt es sich begreifen, wie mit einmal viel zu schnell ohne Übergang ein Abschluss diese Vorstellungsarbeit mit dem Eintritt in die Schule erfährt. Die Jugendzeit, die so wertvoll und einmalig, wird auf Tätigkeiten und Disziplin verwendet, wie Rechnen, Schreiben und Artistisches Betrugen, die der Kunst feindlich sind. Dann erst als erwachsener Mensch darf der Künstler wieder an die eigenen Kräfte und die Arbeit denken, die ihm als Kind ein lebendiger selbstverständlicher Begleiter und eine selbstverständliche Lust waren. Nur wenige haben sich dann noch das natürliche Ausdrucksbedürfnis bewahrt, den natürlichen Trieb ! Bei den meisten ist nur noch das Instrument erhalten, ja und sie wissen nicht mehr, wozu und wie es zu gebrauchen ist. Der eigene Wille wird auf allerlei Abwege gelenkt, wo nur der natürliche Instinkt sein wollte". W. Lämmle 88 Schloßgalerierie "Kastenscheuer", HochdorflEnz
Kunstschrank: * Kabinett.
Kurbelbrustkopf: ("Swivel neck"); Kopf und Hals in einem Stück beweglich in die Brustplatte eingepasst.
Kurbelkopf: Kopf und Hals mit abgerundetem unteren Halsende beweglich in den Puppenkörper eingepasst.
L
Lackarbeiten: Bildeten im 17. und 18.Jh. außer Porzellan das wichtigste Importgut Europas aus Ostasien; sie haben wesentlich beigetragen zur Entstehung der europ. Chinamode (* Chinoiserien). Als Grundstoff diente der Saft des Lackbaumes (Rhus vemificera), der verschieden gefärbt werden kann. Bis zu 40 hauchdünne Schichten Lack werden übereinander aufgetra¬gen; als Veredelung treten Schnitzerei, Bemalung, Gravierung und Einlegearbeit auf. Ihre Blüte erlebte die europ. Lackkunst im 18.Jh.; Zentren waren: Amsterdam (* Kabinettschränke in Schwarz und Gold); London, berühmt für sein leuchtendes Englischrot; außerdem bemalte man in England Eisenblechgeschirre mit Lackmalerei. Bekannt waren auch die Gebrüder Martin (Vernis Martin) in Paris mit ihrer Lackkunst auf Papiermache und in Dresden der hervorragende Lackkünstler Martin Schnell durch einen besonderen Rotlack Schreibschrank: in Braunschweig pflegte Stobwasser die Lackmalerei auf Papiermache für Dosen und Galanterien.
Lambrequin: Zungenförmig ausgeschnittener herabhängender Saum mit Quasten; im * Barock sowohl in Stein wie auch in Bronze umgesetzt.
Laufender Hund: Abart des * Mäanders. Fortlaufendes Hakenmuster, eckig gebrochen oder als Wellenspirale gerundet; in der griechischen und römischen Antike beliebt, auch als Bordürenmuster im Orientteppich verwendet
Lichttaler: Braunschweiger Taler des 16.Jhs. (Harzgulden).
Linieneinlage: Feiner Furnierstreifen aus gefärbtem Holz, gewöhnlich an Rändern zw. breiten Furnierstreifen eingelegt.
Lippenrand: Profilleiste an Schubladenkanten (in England).
Lisene: In zartem Relief vortretender senkrechter Wandstreifen zur Gliederung von Architektur und Möbel.
Lit à fanglaise: Sofaähnliches Bett des * Louis-Seize, zum Aufstellen in Wandnischen bestimmt.
Lit à la duchesse: Bett ohne Bettgerüst mit an der Wand oder an der Decke befestigtem Himmel; löste um 1740 das Pfostenbett (lit´à colonnes) ab.
Lit à la polonaise: Frz. Bett m. kleinem Betthimmel, der von vier Eisenstäben getragen wird, die am Kopf und Fußende befestigt sind; vom Betthimmel fallen Vorhänge herab, die seitlich gerafft werden; in der Mitte des 18.Jhs. entst. Typ.
Lit en bateau: * Kahnbett.
Lösertaler: Silbermünzen der Braunschweig Lüneburger Herzöge von verschiedenem Wert; die Untertanen mussten sie je nach Vermögensverhältnissen kaufen und aufbewahren und konnten sie in Notzeiten einlösen; sie bildeten eine Silberreserve der Herzöge im Land.
Louis Philippe Stil: Frz. Spätklassizismus in Möbeln von etwa 1820 bis 1850; nach dem Bürgerkönig Louis Philippe (1830 bis 1848) benannt; entspricht zeitlich dem dt. * Biedermeierstil.
Louis Quatorze, Louis XIV: Französische Bezeichnung für das * Barock des 17. Jahrhunderts, wird vor allem im Zusammenhang mit Möbeln verwendet.
Louis Quinze, Louis XV: Frz. Bz. für das klassizistische Spätrokoko in Frankreich, vor allem bei Möbeln.
Louis-Seize, Louis XVI: Der nach Ludwig XVI. von Frankreich (1774 1792) benannte europ. Übergangsstil zw. Spätbarock (Rokoko, * Barockstil) und * Klassizismus, der als Kunststil von 1760 bis 1790 gerechnet wird.
Ludwigsburger Fayence und Porzellan: 1758 gründete Her¬zog Karl Eugen von Württemberg in Ludwigsburg eine Porzel¬lanmanufaktur, die auch Fayencen herstellte; die Leitung der Fayencefabrik übertrug er der Witwe Adam Friedrich von Löwenfincks, Seraphia de Becke, die sie bis 1795 innehatte; sie führte die Muffelmalerei m. "feinen Blumen" im Stil von * Straßburg ein; die Porzellanherstellung gelang schließlich nach anfänglichen Schwierigkeiten mit Hilfe Joseph Jakob Ringlers. Es wurden Rokokogeschirre meist m. Füßchen gearbeitet, bemalt m. Schuppendekor, Blumen u. Vögeln. 1824 aufgelöst; als Marke für Fayence u. Porzellan dienten verschlungenes CC, FR, WR; sämtl. m. Krone; od. Geweih.
Lübecker Schrank: * Hamburger Schrank.
Lüneburger Ratssilber: Der Silberschatz des Rates der Stadt Lüneburg; einer der wenigen im Zusammenhang erhaltenen alten Silberschätze, urspr. bis zu 300 Geräte umfassend, jetzt noch aus 37 Gefäßen bestehend (zu sehen im Kunstgewerbemuseum Berlin).
Lüneburger Schrank: Aus Rahmen und * Füllungen gearbeiteter spätgotischer Schrank, der um 1500 in Lüneburg entstand und bis ins 17.Jh., vor allem in Schleswig Holstein, beliebt blieb; man nennt ihn auch Schenkscheibe oder Schenkschiene; zw. den zweitürigen Ober und Unterteilen befindet sich eine von Eisenstäben gehaltene Klappe; dadurch ähnelt er den späteren Aufsatzsekretären; die schönsten Exponate sind mit geschnitzten biblischen Szenen dekoriert.
Lüneburger Truhe: Truhe aus vier Eckstollen mit eingenuteten Eichenbrettern bestehend; in Niedersachsen vom 13.Jh. bis ins 16.Jh. in gleichbleibender romanischer Konstruktion verbreitet.
Lüster: Großer Kronleuchter mit sehr kunstvollen, geschliffenen Glasgehängen aus Bergkristall oder Kristallglas und mehreren Lichtquellen; entstand in Venedig; bereits im 16.Jahrhundert erwähnt, vor allem aber im 18.Jahrhundert beliebt und vielerorts in adeligen und vornehmen Häusern verbreitet.
Lüsterweibchen: In den Renaissance Bürgerstuben beliebter Beleuchtungskörper, in Form einer Frauenbüste, oft ein Wappenschild haltend; rückseitig angebrachte Hirschgeweihe mit schmiedeeisernen Kerzentüllen (Geweihkronleuchter).
Lütticher Möbel: Eichenholzmöbel des 18.Jhs. aus Lüttich mit feiner Rokokoschnitzerei, meist aus * Rocaillen und * Kartuschen; vor allem Schreibmöbel, * Vitrinen, Kleiderschränke, und Bodenstanduhren.
Lyra Back Chair: Engl. Stuhl, von Robert Adam um 1775 entworfen, dessen durchbrochenes Mittelbrett einer griechischen Lyra (Leier) ähnelt.
M
Mäanderband: Rechtwinklig gebrochenes Schmuckband, das nach den Windungen des kleinasiatischen Flusses Maiandros benannt ist; ein antikes Bordürenmuster, das vor allem im * Klassizismus zu Einfassungsintarsien diente.
Mahagoni: Sehr feines, dichtes, hartes Holz von purpurroter oder goldroter Farbe, aus Afrika und Asien importiert. Eignet sich sehr gut zur Oberflächenpolitur.
Mainzer Möbel: Im 18.Jh. war Mainz eine Metropole für die Herstellung meisterlicher Möbel im typischen Geschmack der Zeit; bewegte Aufsatzsekretäre und prächtige Schränke zeugen davon; besonders charakteristisch sind die reich verzierten Anschlagleisten.
Majolika: Bezeichnung für die ital. * Fayence.
Makassarholz: sehr hartes, geflammtes, braunes Holz aus Indonesien.
Marburger Finkentruhe: Im ausgehenden 18.Jahrhundert, vor allem aber in der ersten Hälfte des 19.Jahrhundertkam in der Gegend um Marburg eine charakteristische, regional klar bestimmbare Truhenform auf; in der Mitte meist ornamental ausgesägter Sockel, der links und rechts mit j: einem kleinen Schubfach versehen ist; die Seiten und der Deckel, vor allem aber die Front, sind reich mit den vielseitigsten Motiven intarsiert, wobei die zahlreichen Vogeldarstellungen für den Namen "Finken-Truhe verantwortlich sind.
Marketerie: Furniere (* Furnierung), zu Mustern oder Bildern zusammengesetzt und auf das Grundholz aufgeleimt.
Markstrahlen: Strahlenförmig gelagerte Speicherzellen um das Holzmark; einen dekorativen Effekt ergebend.
Marottes: Steckerlpuppen oder "Schwenkelpuppen" auf einem Stiel meist als Harlequin oder Columbine.
Marquise: * Causeuse.
Maserfurnier: Quer zum Stamm geschnittenes Furnier (* Furnierung), daher mit schöner wolkiger Zeichnung.
Maserung: Verlauf der Holzfasern.
Maskaron: Dekorativ verwendete Maske, vor allem im 17. und 18.Jh. beliebt.
Mattern, Carl Maximilian (1705 1774): Möbelschreiner in Würzburg, der Prunkmöbel für die Residenz schuf, die sich durch virtuose Einlegetechnik (* Intarsie) auszeichnen, während die Proportionen schwerfällig sind. Er beeinflusste das bürgerliche fränkische Möbel und scheint den für Würzburg charakterist. Typus des * Schreibschranks geprägt zu haben.
Medaillon: Bei Bauernmöbeln Bild in ovalem Rahmen, hauptsächlich in Türfüllungen oder Truhenfeldern vorkommend.
Meißen: Erste europ. Porzellanmanufaktur, die von Johann Friedrich Böttger (1682 1719), dem Erfinder des europ. Hartporzellans, 1710 begründet wurde, zunächst in Dresden; bald wurde sie aus Gründen der Geheimhaltung in die Albrechtsburg in Meißen verlegt. Unter Böttgers Leitung (bis 1719) wurden unter großen Anfangsschwierigkeiten Böttgersteinzeug und die ersten Porzellane hergestellt, deren Formen sich an Silbervorbilder anlehnten. Der Aufschwung erfolgte unter dem aus Wien gekommenen Maler Johann Gregorius Höroldt (1696¬1775), der die Farben verbesserte und Porzellane mit Chinesendarstellungen in Gold, später mit farbigen Hafen und Parklandschaften in Kartuschenrahmen bemalte. Damals arbeitete auch Göwenfinck in Meißen. Um 1730 machte man sich von den chinesischen Vorbildern frei. Die ostasiatisch beeinflussten "indianischen" Blumen wurden durch naturalistische dt. Blumen ersetzt (nach Kupferstichvorlagen, mit Schatten dargestellt, daher die zeitgenössische Bz. "Saxe ombrée", frz. "Sächsisch mit Schatten"). Die indianischen Blumen lebten fort in dem von 1735 bis heute hergestellten "Zwiebelmuster" (Pfirsiche, Astern, Granatäpfel) in Unterglasurblau. Ihre Blüte erlebte die Manufaktur unter der Leitung des Grafen Brühl, der von 1733 bis 1763 in Meißen arbeitete. Der Künstler, der ihren Weltruhm begründete, war Johann Joachim Kaendler (1706-1775, seit 1731 in Meißen,1733 bis 1775 Modellmeister). Erhat die zahlreichen Geschirrformen der Manufaktur entworfen und einen materialgerechten Porzellanstil geschaffen.
Menuisier: Frz. Begriff für Tischler, d.h. dem einfachen Möbelschreiner, im Gegensatz zum Kunstschreiner, dem * Ebenisten.
Metallmöbel: In Deutschland im 19.Jahrhundert eingeführt (u.a. Schinkel).
Meuble d'appui: Kommodenartiges Schränkchen mit zwei Türen, meist paarweise aufgestellt; vor allem im * Louis-Seize beliebt und verbreitet.
Meuble d'entre deux: Halbhoher Schrank oder Kommode mit Fächern an beiden Seiten, die in den meisten Fällen offen sind.
Miniatur: Malerei in winzigem Format; Blütezeit der Buchminiaturen in der * Gotik, der Gemälde Miniaturen (auf Kupfer, Elfenbein, Porzellan etc.) im 18.Jh. und im * Biedermeier.
Mitteldeutsche Möbel: Hierzu zählen sächsische Schreinererzeugnisse mit den Herstellungszentren Dresden und Erfurt.
Möbel: (Lat.mobilis = beweglich); heute die Vielzahl von ;Einrichtungsgegenständen, die zur Aufbewahrung der Habe und zum Wohnen entwickelt wurden.
Möbelfüße: Verschiedenste Ausführungsarten: * Cabriole-leg, ' 4~.~Claw and ball foot, * Club-foot, * Geißfuß.
Möbelsignaturen: Die frz. * Ebenisten und * Menuisiers des 18. Jhs. waren durch Zunftgesetz verpflichtet, ihre Möbel zu signieren. Ausgenommen waren nur Kunstschreiner, die in direktem königlichen Auftrag oder für die königliche Kammer, das Garde-Meuble de Paris, arbeiteten. Die meisten Möbel des 18.Jhs. sind aufgrund dessen durch Brand oder Blindstempel ihrer Meister gekennzeichnet, die an unauffälligen Stellen (unterhalb der Zarge, an den Hinterbeinen) angebracht sind. Man kann sie in Markenhandbüchern nachschlagen.
Münzschrank: (Frz.= m6daillier); Schrank zur übersichtlichen Aufbewahrung einer Münzsammlung; im 17.Jh. dienten dafür die * Kabinette mit ihren vielen Schubladen, im 18.Jh. entstand ein dreiviertelhoher Schrank mit zahlreichen flachen Schüben, die mittels zweier Türen verschlossen werden.
Muschel: ein oft gebrauchtes Motiv aus der * Renaissance und dem * Barock bzw. * Rokoko (Rocaille).
N
Nachttisch: Im späten 18. und vor allem im 19.Jh. erhielt das dem Bett beigestellte Kleinmöbelstück seine absolut typische Form; halbhohe Beine tragen einen Kastenkorpus, unten mit einer Tür, darüber eine Schublade; damit die auf der Platte abgelegten Sachen in der Nacht nicht so leicht heruntergeworfen werden können, verlief an drei Seiten der Plattenkante eine überstehende Leiste.
Nadelhölzer: Fichte, Kiefer und Tanne, weiche und langfaserige Holzarten; in Süddeutschland und den Alpenländern für frühe und rustikale Möbel, später meist als * Blindholz verwendet; daher auch als unedles Holz bezeichnet.
Nähtisch: Ein im späten 18.Jahrhundert in England entwickeltes Tischchen zum Aufbewahren von Näh und Handarbeitsutensilien, meist mit aufklappbarer Platte und unterteilter Schublade; im * Biedermeier beliebt und oft kugelförmig als "Globustischchen" ausgebildet.
Nasenschrank: * Frankfurter Schrank.
Naturalismus: In Malerei und Plastik eine Richtung (zu fast allen Zeiten), die größtmögliche Naturneue erstrebt.
Neu Barock, Gotik, Romanik: Getreues Nachbauen im Stile alter Epochen; vor allem im 19.Jh. beliebt.
Norddeutsche Möbel: Traditionsbewußter, bauerntümlicher Möbelstil; regional differenzierte, insgesamt aber charakteristische Bauernmöbel in Eiche gearbeitet, meist dunkel gebeizt, selten partiell bemalt; zurückhaltend vornehmer und schlicht gebliebener Einrichtungsstil (* Hamburger Schapp, * Danziger Tisch und Schrank).
Nürnberger Schrank: Nürnberger Schranktyp des 16.Jahrhunderts in der Art der süddeutschen * Fassadenschränke, mit mittlerem Schubladenstreifen, jedoch mit betonterem Kontrast zwischen Füllung und Rahmen; die Rahmen aus mattem Nussbaumholz sind durch * Pilaster und Schnitzereien hervorgehoben, während die * Füllungen aus hochglänzendem, spiegelnd poliertem Eschenholz sind.
Nussbaum: Beliebtes Edelholz der dt. und frz. Kunstschreinerei vom Ausgang des 17. bis zum Ende des 18.Jhs.; meist als * Furnier verwendet. In Längsrichtung zersägt entsteht das gewöhnliche, hellbraune Nussbaumfurnier mit schwärzlicher Maserung; quergesägt ergibt es das Maserfurnier mit schwarzer wolkiger Zeichnung; sägt man den inneren Kern des Stammes in Querrichtung, so erhält man das dunkle Wurzelmaserfurnier.
Nut, Nute: Bezeichnung für eine Holzverbindung bei Möbeln: eine längliche Vertiefung, in welche die "Feder" (eine vorspringende Leiste des entsprechenden Holzteils) gesteckt wird; es gibt viele Variationen von Nut und Feder, sie waren die Voraussetzung zur Rahmenkonstruktion in der Möbelkunst.
O
Ochsenkopfstuhl: Biedermeierstuhl mit schmalerem Lehnenbrett als der * Schaufelstuhl, ohne Zunge.
Ofenschirm: Rahmengestell auf gespreizten Füßen; meist mit einer Textilbespannung versehen; hatten zuvor figürlich ausgestaltete Kaminvorsätze oder Funkengitter die offenen Kamine abgeschirmt, so schützte man sich gegen Ende des 18.Jhs. und in der ersten Hälfte des 19.Jhs. durch Ofenschirme vor der Hitze von Kamin und Ofen.
Ohrenbackensessel: * Stuhl bzw. Sessel.
Ohrmuschelstil (1620 1650): Spätform des * Knorpelstils, mit Ornamentformen, die an Ohrmuscheln erinnern.
Ornamentstiche: (Vorlagenstiche); Grafiken mit Ornamenten und Kunstgewerbe Entwürfen, die Kunsthandwerkern als Vorlagen dienten; seitdem 15.Jh. bekannt; bald bildeten sie sich zu einer eigenen Kunstgattung aus; vor allem im 17. und 18.Jh. entstanden Ornamentstiche in großer Zahl und übten die breiteste Wirkung aus.
P
Paperweightaugen: Bes. ausdrucksstarke Glasaugen, die in ihrer Tiefenwirkung den Paperweights ähnlich sind.
Papiermache: Material aus Papier und Leimlösung mit diversen Zusätzen wie Stärke, Gummi, Gips, Kreide oder Ton, vor allem in Italien seit dem 15.Jh. bekannt; 1805 für Spielzeug patentiert; Verarbeitung durch Drücken in Formen, ab 1894 auch gegossen. Mitte des 19.Jhs. wurde Papiermache bes. in England zur Dekorierung von Möbeln und zur Reliefierung bei Rahmen verwendet.
Paravent: (Frz. = "Windschutz"); bei uns oft auch Spanische Wand; Stellwand aus mehreren hochrechteckigen Feldern, die durch Scharniere verbunden sind.
Parketterie: Geometrische oder Würfelmarketerie.
Parian: In England erfundenes, unglasiertes, hartes, cremeweißes, porzellanähnliches Material; benannt nach seiner Ähnlichkeit mit dem Marmor der griech. Insel Paros; ohne Farbgebung. Zw. 1850 und 1870 hauptsächlich für Puppenköpfe in Mode.
Parisiennes: Damenhafte Puppen oder sog. Lady Dolls der renom. Puppenhersteller m. reicher Ausstattung in erstklassiger Ausführung; hervorragende Biskuitköpfe meist aus Lederbälgen, in Deutschland hauptsächlich mit Compositionskörpern.
Patentsekretär: Transportabler kleiner Schreibschrank; typisches Biedermeiermöbel.
Patina: Die durch Verwitterung von Metall auf seiner Oberfläche entstehende grünliche oder braune Schicht; bei Bronzen wegen ihrer Schönheit stets unberührt gelassen; wird oft gefälscht.
Pembroketischchen: Um 1750 entstandener tragbarer Tischtyp, 64 cm hoch; oval oder rechteckig mit abgerundeten Ecken und hochklappbaren Seitenteilen mit Konsolstützen; unter der Tischplatte befinden sich ein oder zwei Schubladen.
Perlstab: Schmuckmotiv, bestehend aus kleinen perlenähnlichen, nebeneinandergereihten Kugeln; bisweilen als obere und untere Begrenzung eines * Eierstab Frieses.
Pfeifendekor: Gerade * Kannelüren nennt man Pfeifen, während die geschweiften als Melonenrippen bezeichnet werden.
Pfeiler: Kantige Stützen im Gegensatz zu den stets runden Säulen.
Pfeilerkommode: * Chiffonière
Pied-de-biche: * Geißfuß
Pietra-dura-Inkrustation: Marmormosaik aus verschiedenfarbigen Marmorplättchen; die Einlegearbeit, die in der 2 Hälfte des 16. Jh. in Florenz und Turin als Verzierungstechnik aufblühte, fand zu Beginn des 17. Jh. an dt. Fürstenhöfen (München, Kassel, Braunschweig) zur Verzierung von Prunkmöbeln Anwendung.
Piaster: flacher Wandpfeiler
Pommerscher Kunstschrank: * Augsburger Kabinett.
Portiere: Türvorhang mit Quastenbesatz; in der zweiten Hälfte des 19.Jhs. beliebt.
Porzellan: Der wesentliche Unterschied zu den * Fayencen liegt in der im Material komplizierteren und feineren Zusammensetzung (Kaolin, Feldspat und Quarz); P. wird auch mit höheren Temperaturen (1400 Grad) und zweimal gebrannt.
Poudreuse: * Toilettentisch.
Pouffe: Hocker mit hohem Polster; bes. in der zweiten Hälfte des 19.Jhs. in Frankreich beliebt.
Prie-Dieu: * Betschrank.
Prismierung: Im Möbelbau die Anschrägung des Randes einer meist gerahmten Platte oder eines eingesetzten Glases.
Psyche: Drehbarer Standspiegel; im * Empire und Biedermeier weit verbreitet und beliebt.
Pultschreibtisch: * Damenschreibtisch.
Punzierung: Mit Hilfe von Punzen (Stahlstifte oder Stempel) eingetriebener Dekor, oft im Zusammenhang mit Schnitzerei.
Putte: Zierfigur einer kleinen Amorette; aus der röm. Antike übernommen und bes. im * Barock beliebt.
Pyramidenfurnier: Wird der Schnitt durch die Ausgabelung des Stammes geführt, so entsteht ein Furnier (* Furnierung) mit Pyramidenmaserung.
Pyrographie: * Brandmalerei.
Q
Quartetto-Tische ("nest of tables"): engl. Bz. für Satztische, die untereinandergeschoben wurden und meist, zu viert, ein Quartett bildeten; beliebtes Möbel des * Regency.
Queen-Anne-Style: Spätbarocker, engl. Stil in Architektur und Kunsthandwerk während der Regierungszeit der Königin Anna (1702 1714), der jedoch bis um 1750 von Einfluß war; entspricht etwa dem kontinentalen * Barock und * Rokoko.
Queen-Anne-Puppe: In England seit dem 18.Jh. beliebte, gedrechselte Holzpuppe mit beweglichen Gliedern und im Verhältnis zu großem, handgeschnitztem Kopf, in einem Stück gearbeitet; kräftig aufgemalte Gesichtszüge, oft mit eingesetzten Glasaugen und kleinem Mündchen; charakteristisch sind die kleinen Hände mit rechenartig eingekerbten Fingern.
Querfurnier: Furnierstreifen (* Furnierung) entlang einer Kante und dem Faserverlauf entgegen.
R
Rahmenkonstruktion: Seit dem 15.Jh. bis ins 17.Jh. in Mitteleuropa angewandte Konstruktionstechnik bei Möbeln; ein tragendes, aus Kanthölzern gebildetes Rahmenwerk wurde durch Zapfenverbindungen zusammengefügt, in das Füllbretter eingepasst wurden, die an den Kanten abgeschrägt und in die Rillen des Rahmens eingelassen wurden; die Zapfenverbindungen befestigte man zusätzlich durch Holzdübel.
Rankenornament: Freigestaltetes pflanzliches Dekorationsmotiv; meist in der Form von Akanthusranken.
Realismus: (Von lat. realis = wirklich), in der Erkenntnislehre: die Anschauung, es gäbe eine vom menschlichen Denken unabhängige, aber in ihm erkennbare Wirklichkeit (Problem der Realität). In der Kunst eine häufig als Opposition gegebene ältere, konventionell gewordene, idealisierende oder stilisierende Richtungen aufkommende Kunstweise; sie fordert Naturnähe, Unbefangenheit des Blickes und Unmittelbarkeit.
Récamier: Aus der * Veilleuse entwickelte Liegebank des Empire; erhielt ihren Namen nach Julie Récamier (1777 1849), in deren Salon sich in der Revolutions und Restaurationszeit das geistige Paris traf.
Refugium: (Lat.), Zufluchtsstätte.
Régence: * Barockstil.
Regency: * Klassizismus.
Relief: (Lat. relevare = erheben); erhabene Schnitzerei von Figuren und Ornamenten aus einem ebenen Hintergrund herausgearbeitet.
Renaissance: Eine zuerst von dem ital. Kunsthistoriker Vasari 1550 benutzte Bz., ital. rinascimento = Wiedergeburt (der Antike); die Bz. ist erst seit 1850 im allg. Gebrauch; die R. entstand im Zusammenhang mit der techn. Entwicklung und der wirtschaftl. Blüte Italiens im 15.Jh. als gewaltige Entfaltung der Kunst, die vom neuen kapitalistischen Bürgertum finanziert wurde; die Vorbilder stammten aus der * Antike, verbanden sich aber mit techn. Experimenten und Überlegungen zur Perspektive und Komposition und einem neuen sachl. Interesse für die Wiedergabe des nackten Körpers; im Mittelpunkt des Interesses steht die individuelle künstlerische Leistung; in der Möbelkunst greift die R. auf antike Formen und Ornamente zurück und gliedert das Mobiliar streng mit einer Betonung der Horizontalen; hierbei finden Profilleisten und Gesimse mit Zahnschnitt, * Eierstab und andere klassischen Omamentenborten Anwendung; die senkrechte Gliederung übernehmen Säulen nach antiken Vorbildern, * Karyatiden und * Pilaster; auch figürl. Schnitzerei am Rahmenwerk und in den* Füllungen verraten oft ihre antiken Vorbilder. Man unterscheidet in der ital. R. folgende Perioden: Früh-R. 1420 1500, Hoch-R. 1500 1530, Spät-R. (Manierismus) 1530 1600; in Frankreich Louis XIL 1480 1558; in England (* Tudorstil) 1485 1558, Elisabeth Stil 1558 1625; in Spanien (Plateresco) 1480 1558; in Deutschland: Früh-R. 1520 1570, Spät-R. 1570 1620.
Restauration: Die Kunst der Restauration (1820 1850) nennt man in Deutschland nach dem "Biedermann" (* Biedermeier).
Rhöntisch: * Kastentisch.
Rocaille: (Frz. = Grotten und Muschelornament); Schmuckmotiv aus leicht ausgehöhlten, wie Muscheln geriffelten und ausgefransten Formen, die an vor und zurückschwingende Kurven angesetzt sind; das wichtigste und häufigste Schmuck . Motiv des * Rokoko.
Roentgen, Abraham (1711 1793): Bekannter Kunstschreiner; seit 1750 in Neuwied bei Koblenz tätig, wo sein Hauptauftraggeber, der Kurfürst von Trier, lebte; 1772 gab er die Leitung der Werkstatt an seinen Sohn David ab, war jedoch bis 1775 tätig; seine Möbel zeigen schweren, kraftvollen Aufbau und leugnen seine holländisch englische Schulung nicht.
Roentgen, David (1743 1807): Berühmtester dt. Kunstschreiner, Sohn von Abraham; er errichtete Filialwerkstätten in Paris; stand bei Fürsten und Künstlern seiner Zeit in hohem Ansehen; ab 1770 wird die Bildintarsie eine Spezialität seiner Werkstatt; mannigfaltige Entwürfe lieferte der Maler Januarius Zick; ab 1778/79 arbeitete Roentgen in * Louis-Seize-Formen und führte das * Mahagoni in Deutschland ein; berühmt waren seine Schreibtische, an Feinheit des Details und Raffinesse des Mechanismus überragen sie alle zeitgenössischen dt. Möbel; als die Franzosen im Jahr 1795 Neuwied besetzten, mußte David Roentgen seine Werkstatt schließen.
Rokoko: * Barockstil.
Rollbureau: * Zylinderbureau.
Rollwerk: Dekorationssystem aus Bändern und Stegen, deren Enden sich einrollen; seit der Mitte des 16.Jhs. allg. in Europa gebräuchlich; wird auch Floristil genannt nach dem Antwerpener Ornamentstecher Cornelis Floris (1514 1575), der mit mehreren Stichfolgen wesentlich zu seiner Verbreitung beitrug.
Romanischer Stil (Romanik): der erste Europa umfassende Kunststil des MA. (ca. 1030 1200).
Romantik: Eine gegen Ende des 18.Jhs. einsetzende Geistesströmung gegen die Kälte der Aufklärung und des * Klassizismus, mit einem Hang zum Elegischen und Melancholischen; sie hat die Kunst mehrerer Epochen, vor allem die des Biedermeier überlagert und beeinflusst.
Rosenholz: Auch "Königsholz" oder "Palisander" genannt; grobkerniges Holz mit unterschiedlicher Härte; dunkelrotbraun, schwarz oder schwarzbraun gestreift; kommt aus Brasilien und von den westindischen Inseln; im 18.Jh. für Marketerie (* Furnierung) beliebt.
Rosette: Ornament einer von oben gesehenen Blüte, kreisrund stilisiert in blattförmig. Strahlen.
Rößler,Johann Michael (1791 1849): Sohn des Untermünkheimer (Hohenlohe) Schreinermeisters Johann Heinrich Rößler (1751 1832); 1,804 Lehrling bei seinem Vater, 1816 Meister, 1817 Heirat, 1829 Zunftmeister, 1834 Schreinerobermeister, 1843 zweite Heirat; die sog. "Rößler-Kästen", Bauernschränke mit * Rocaillen, Blumenkorb, Amselpaar, bäuerlichen Figuren und Szenen und herzhaften Sprüchen bemalt, signierte Johann Michael, wie viele seiner Werke (Truhen, Betten, Wiegen, Tische, Stühle etc.), in so seltener Form mit "J.M. Rößler, Schreinermeister zu Münkheim" und machte ihn zum bedeutendsten Landschreiner seiner Zeit.
S
Säulen: Zählen zu den wichtigsten architektonischen Formen, die auch zur Gliederung und Gestaltung von Möbeln verwendet werden; vor allem die Fassadenschränke der * Renaissance bedienten sich dieser Elemente, aber auch im * Barock blieben sie beliebtes Gestaltungsmittel.
Säulengliederung: Unterteilung einer Säule in * Base, Schaft und * Kapitell.
Säulenkommode: Säulenstumpfartig gearbeitete Zierkommodenform des * Klassizismus.
Satztische: Ein Satz von zwei bis vier kleinen Tischen in abgestuften Größen, die, wenn sie nicht benutzt werden, raumsparend untereinander geschoben werden können; ein typisches * Regency-Möbel.
Savonerola-Stuhl: Mittelalterlicher * Scherenstuhl aus Holzrippen, oft kunstvoll gearbeitet.
Schälfurnier: Seit dem 19.Jh. wird Furnierholz (* Furnierung) nicht mehr gesägt, sondern vom sich drehenden Stamm "abgeschält", wodurch die Furnierstärke auf sehr dünne Blattstärken reduziert werden konnte (bis zu 0,05 mm).
Schapp: * Hamburger Schrank.
Schaufelstuhl: Biedermeierstuhl mit oben breiter, seitlich in * Voluten abgerundeter Lehne.
Schemel: * Hocker.
Schenkschieve: * Lüneburger Schrank.
Scherenstuhl: * Faltstuhl.
Schichtholz: Verleimte Holzschichten mit parallelem Faserverlauf, dadurch sehr standfest und verwindungsarm.
Schlagstempel: * Möbelsignaturen.
Schloßstulp: Freiliegender Teil eines Möbeleinsteckschlosses, der den Verschlußriegel aufnimmt.
Schreibkasten: * Kabinett.
Schreibkommode: Im späten 18.Jh. auftretende Kommode, deren oberste Schublade, herausgezogen, als Schreibunterlage mit herunterklappbarem Vorderteil diente.
Schreibschrank (Tabernakelschrank, Aufsatzschrank): Schrank mit kommodenartigem Unterteil und zweitürigem, giebelgekröntem Aufsatz (mit Schließfach und Schüben); dazwischen ein eingeschobener mit Schubfächern versehener Mittelteil, dessen Pultdeckel als Schreibplatte heruntergeklappt werden kann; im frühen 18.Jh. in England geschaffen, wurde er zum meist verbreiteten Möbel in Deutschland, wo er bes. in Würzburg, Mainz und Dresden zum Prunkmöbelstück ausge¬bildet wurde; in seiner Zeit Trisur genannt.
Schuppentruhe: * Truhen.
Schweifwerk: * Beschlagwerk.
Secretaire à deux (à trois) corps: Zwei bzw. dreiteiliger * Aufsatzsekretär.
Secretaire en armoire (Secretaire à abattant): Schreibschrank, hochrechteckig, meist mit zwei Türen im Unterteil, im Mittelteil eine herunterklappbare Schreibplatte, dahinter zahlreiche Fächer und Schübe; seit 1760 in Frankreich in Gebrauch, dann auch in anderen Ländern und besonders im frühen 19.Jh. sehr beliebt (Klappsekretär).
Secretaire à cylindre: * Zylinderschreibtisch.
Secretaire en pente: Pultschreibtisch mit schräger, herunterklappbarer Verschlussplatte, zugleich Schreibplatte, um 1730 in Frankreich entstanden.
Sekretär: Hochrechteckiger Schreibschrank, dessen Unterteil Türen oder Schübe zeigt; der Schübe und Fächer enthaltende Mittelteil wird von einer senkrechten Platte verschlossen, die, heruntergeschlagen, als Schreibplatte dient; eine flache Schublade bildet meist den oberen Abschluss; wurde um 1760 von Oeben und Riesener ausgebildet und lebte in dieser Form bis ins 19.Jahrhundert fort; gehörte zu den Lieblingsmöbeln des * Empire und * Biedermeier, enthält oft ein oder mehrere geschickt versteckte Geheimfächer für wichtige Dokumente oder wertvolle Dinge.
Servante: Kleiner, zum Servieren benutzter Beistelltisch des späten 18.Jhs.
Settee: Kleines, doppelsitziges, engl. * Canape des 18.Jhs.; in noch kleinerer Form entspricht es der frz. * Causeuse.
Sgabello: Reich ausgebildeter italien. Schemel (* Hocker).
Sheraton: Engl. klassizistischer Möbelstil Ende des 18.Jahrhunderts, benannt nach dem englischen * Ebenisten Thomas Sheraton (1751 1806).
Side-board: Niedrige, engl. * Kredenz des 16.Jhs.
Side Table: Engl. Wand oder Seitentischchen aus Eiche und sehr massiv (17.Jh.); später der * Konsole angenähert und häufig reich geschnitzt; durch Robert Adam auch halbmondförmig gestaltet (* Side-board).
Silbermöbel: Tische und Stühle aus massivem Silber; um 1700 ließen sich einige europäische Höfe Silbermöbel in Augsburg arbeiten, mit dem Hintergedanken, sie in Notzeiten wieder einschmelzen zu können; ein Schicksal, dem nur wenige dieser Möbel entgangen sind.
Sitzmöbel: Zusammenfassende Bz. für alle zum Sitzen dienenden Möbel, unter anderem * Bank, Hocker, Stuhl und Sessel, im Unterschied zu Kastenmöbeln, Tischen und Betten.
Sockelkopf: Kopf, Hals und Brustplatte aus einem Stück gearbeitet.
Sofa: Aus dem Arabischen stammende Bz. für * Canapé.
Sofatisch: rechteckiger, aus dem * Pembroketischchen entwickelter Tisch, meist mit Seitenklappen, der vor dem Sofa seinen Platz hatte.
Sommer: Künstlerfamilie (Kunstschreiner) aus Künzelsau; in der Zeit zwischen 1630 bis 1816 (Barock) schufen zwölf handwerklich und künstlerisch begabte Mitglieder dieser Familie in fünf Generationen eine Fülle von Werken für Kirchen und Kapellen, für Schlösser, Burgen und Parkanlagen, aber auch für einfachere Häuser und Wohnungen. Daniel Sommer (1643 ?) führte die Metall Schildpattindustrie in Deutschland ein und gab dem deutschen * Barockstil im Sinne des französischen Vorbilds neue Impulse.
Spätbarock (Rokoko): * Barockstil.
Spätgotik: Letzte Phase der * Gotik.
Spanische Wand: * Paravent.
Sperrholz: Verleimte Holzschichten, deren Fasern abwechselnd in Längs und Querrichtung verlaufen.
Spiegelschnitt: Gegeneinandersetzen von Furnierflächen (* Furnierung) in Hell Dunkelmanier.
Spindler, Johann Friedrich (gest. nach 1793): Einer der bedeutendsten dt. * Ebenisten; 1754 mit seinem jüngeren Bruder Heinrich Wilhelm in Bayreuth tätig, wo er Möbel für das neue Schloss arbeitete, die durch meisterliche Marketerie und Bronzen im frz. Stil auffallen; seit 1764 in Berlin; dort schuf er mit seinem Bruder Kommoden, Schränke und Tische für das neue Palais in Potsdam, die sich durch vorzügliche * Marketerie in holzfremden Material auszeichnen.
Splintholz: Randteile des Holzstammes, die das Kernholz umgeben, zum Verarbeiten meist schlecht geeignet, da zu weich und nicht standfest, außerdem nicht maßhaltig, wird vor dem Verarbeiten des Holzes an den Dielen oder Bohlenseiten abgetrennt ( Besäumen des Holzes ).
Steg: Verbindungsholz zwischen den Stuhl und Tischbeinen, dient der Stabilität, besonders bei sehr dünnen Beinen oder sehr großen Beinabständen bei Tischen.
Steifhalspuppen oder Stiff-neck-Puppen: Kopf und Rumpf unbeweglich, in einem Stück gearbeitet.
Stilmöbel: Möbel, die zu einer späteren Zeit mit den stilistischen Merkmalen einer früheren Epoche, d.h. deren Stil nachahmend, gefertigt sind (* Historismus).
Stollenschrank: Dem frz. * Dressoir verwandter, rheinischer und flandrischer Anrichteschrank des 15. und 16.Jhs.; aus Eiche gefertigt und als Kasten auf hohen Eck Stollen stehend. Surrealismus: Eine Richtung der Malerei, 1924 in Frankreich durch A.Bretons " Manifeste du Surrealisme" begründet; fußt auf Erfahrungen des * Dadaismus, des literarischen S. (Rimbaud, Apollinaire, Eloucard) und der Psychoanalyse S. Freuds; will die Welt des Unbewussten, Traumhaften, Ästhetik und Moral zur Erscheinung bringen.
Süddeutsche Möbel: Typisch sind * Nürnberger Schrank und * Ulmer Schrank.
T
Tabernakel: Urspr. Schrank für Hostie und Kelch auf dem Altar; bei der Möbelkunst ein von Schubladen umgebenes Schrankfach in einem Möbelaufsatz zur Aufnahme der Heiligtümer des privaten Haushalts.
Tabernakelmöbel: Mit der Schreibkommode würde der Tabernakelaufsatz zum beliebtesten Möbel des frühen 18.Jhs., dem Tabernakelsekretär; aber auch in Verbindung mit anderen Unterteilen, wie Halbschrank oder Kommode, kommt der Tabernakel als Aufsatzmöbel vor.
Table à la Bourgogne: * Satztische.
Table à ouvrage: * Nähtisch.
Table de nuit: * Nachttisch.
Table en Chiffonnière: Zierliches, leichtes Tischchen mit einer oder mehreren Schubladen, Tablett zw. den Tischbeinen; dieses Rokoko Möbel, dessen Tischrand oft mit einem Gitterehen versehen war, diente in Damenzimmern des * Louis-Seize meist als Handarbeits und Nähtisch.
Tablier: Schurzförmig herabhängende, häufig durch ein Schmuckmotiv betonte Zangenmitte.
Tabouret: Niedriger, gepolsterter * Hocker; um 1700 in Frankreich entstanden; die vier kurzen Beine sind oft durch Sprossen verbunden, vermittelt ein stabiles Aussehen.
Täufling: Von Eduard Lindner unter dem Eindruck einer ostasiatischen Puppe nach der Londoner Weltausstellung im Jahre 1851 entworfene Babypuppe, mit einem Hemdchen bekleidet; in den Holz beziehungsweise Papiermachekörper eingesetzte Stoffpartien ermöglichen die Beweglichkeit der Gliedmaßen; Hände und Füße sind, locker an Drähten eingehängt, ebenfalls drehbar und voll beweglich.
Tallboy: Zweiteilige engl. Aufsatzkommode, die zwei aufeinandergestellten Kommoden (chests) entspricht, weswegen sie auch "ehest an ehest" (Doppelkommode) genannt wird; seit dem späten 17.Jh. in Gebrauch.
Tannenholz: * Nadelholz.
Tanzdocken: Gedrechselte Holzpuppen auf Borsten, die beispielsweise auf eine Zither gestellt, sich durch die Vibration beim Spiel bewegen.
Tapisserie: Gewirkter oder gestickter, aufwendig gearbeiteter Wandteppich (* Gobelin).
Teetisch: Kleiner, runder, in England entstandener Tisch des 18.Jhs.; meist auf einem Dreifuß stehend; oft aus * Mahagoni; die Platte kann zuweilen hochgeklappt werden.
Tête à tête: * Causeuse.
Thonet, Michael (1796 1871): Dt. Kunsttischler aus Boppard (Rheinland); arbeitete später in Wien; entwickelte seit 1830 das sog. Thonet Verfahren, eine Technik zur Herstellung von * Bugholz Möbeln (hauptsächlich Stühle).
Toilettentisch (Poudreuse): Im 17.Jh. entstandener Tisch für Toilettengegenstände, der während des 18.Jhs. oft sehr raffi¬niert ausgestaltet war; die Mitte der Deckplatte, an der ein Spiegel angebracht war, konnte aufgeklappt und hochgestellt werden; häufig mit zahlreichen Schubfächern ausgestattet, manchmal auch mit Schreibtisch oder Lesetisch kombiniert; im 19.Jh. kamen die T. mit dreiteiligem, auf der Platte befestigtem Spiegel in Gebrauch.
Trapezgiebel: Giebel eines Möbels in Form eines Vierecks mit zwei Parallelen, aber ungleich langen Gesimsschenkeln.
Tricoteuse: (Frz. = Strickerin); dem * Nähtisch entsprechendes Arbeitstischchen des 18.Jhs.
Tripod-table: Engl. Gegenstück zu den Ziertischchen des frz. Rokoko; die runde oder viereckige Platte kann oft umgeklappt werden; sie ruht auf einem von drei oder vier geschweiften Füßen getragenen Schaft.
Trisur: * Schreibschrank.
Trittleiste: Unten um das Tischgestell laufende Leiste, auf welche die Füße aufgestellt werden können und, die außerdem die Standfestigkeit des Tisches erhöht.
Trommelkommode: Der Säulenkommode ähnlich; hat die Form einer großen Sturmtrommel.
Truhe: Das älteste Kastenmöbel, das schon die Antike kannte; zur Aufbew. von Wäsche, Kleidung, Kostbarkeiten, aber auch Lebensmitteln (* Marburger Finkentruhe, * Lüneburger Truhe, * Koffertruhe, * Brauttruhe, * Dachtruhe, * Cassone u.a.).
Truhenbank: * Bank, * Cassapanca.
Tudorstil: Engl. Spätgotik im 16.Jh.
U
Überbauschrank: Kölner Schranktyp des 16.Jhs., der den * Stollenschrank ablöste; breites, hohes Untergeschoss trägt einen zurückgesetzten, schmaleren Aufbau, dessen vorkragendes Gesims von Pfeilern, Säulen oder Figuren gestützt wird.
Umlaufender Hund: Geometr. Muster wie Kleeblattranke, Flechtband, Schuppen und Wellenmäander sind als gleichförmige, fortlaufende Schnitzmuster um ganze Möbelteile oder * Füllungen gezogen; als Sonderheit im Bergischen Land bekannt und verbreitet.
V
Vefeuse: (Frz. = Wächterin); * Canapé des Rokoko mit asymmetrischer Rückenlehne, die auf der einen Seite höher und weiter herumgezogen ist als auf der anderen; V. wurden stets paarweise zu Seiten eines Kamins aufgestellt; ihr entspricht im Klassizismus das * Récamier.
Verdüre: Ein Typ von * Tapisserie, der keine figürlichen Darstellungen, sondern ausschl. Blatt und Rankenwerk zeigt.
Verkröpfung: Vorspringende, mehrfache Abwinkelung einer Leiste oder eines Gesimses.
Vermeil: Vergoldetes Silber; oft bei luxuriösem Tafelgerät des Empire und Klassizismus anzutreffen.
Vernis Martin: * Lackarbeiten.
Vitrine: Verglaster hoher Schrank, häufig mit kommodenartigem Unterbau; gegen Ende des 17.Jh. in Holland entwickelt; im 19.Jh. als Schauschrank beliebt.
Volute (Schnecke): Spiralförmig eingerolltes, wulstiges Ornament, das in der Renaissance und im Barock im Kunstgewerbe und auch in der Möbelkunst als Ziermotiv diente.
Vorholrahmen (Flammleistenrahmen): * Flammleiste.
Vorkragen (auskragen): Gleichbed. wie herausragen, im Zusammenhang m. Gesims oder Kranz bei Möbelstücken.
Voyeuse: Frz. Stuhl mit niedrigem Sitz und hoher gepolsterter Rückenlehne, auf dem man rittlings sitzen und die Arme auflegen konnte; um 1740 entstanden.
W
Wange: * Kastentisch.
Wangentisch: * Kastentisch.
Wellenschrank: * Frankfurter Schrank.
Whatnot: Engl. Bezeichnung für die * Etagere.
Wiener Sezession: Träger des Jugendstils in Österreich.
Windsor Stuhl (Windsor Chair): Ländl. engl. Stuhl mit meist halbrunder, aus gedrechselten Rundstäben gebildeter Lehne, der Ende des 17.Jh. in England entstand.
Wirbelrad: Der Rosette verwandtes Ornament, bei dem von einem gemeinsamen Kreismittelpunkt ausgehende, geschwungene Linien den Eindruck einer Drehung entstehen lassen.
Wrangelschrank: Berühmter * Kabinettschrank mit ähnlicher Geschichte wie der * Augsburger Kabinettschrank; dieser nach seinem ehemaligen Besitzer (Graf Wrangel) benannte, 1566 datierte Wrangelschrank ist eines der wertvollsten Möbelstücke der dt. Renaissance; von größter Bedeutung sind außen und innen die * Intarsien des sonst einfachen zweitürigen Schrankes, Bildfelder mit phantastischen Landschaften, Fabeltieren, Ruinenarchitekturen etc., wie sie auch in der Malerei des 16.Jahrhunderts vorkamen.
Würfelintarsie: Marketierung in Form von plastisch dargestellten Würfeln in einer Vielzahl auf und nebeneinander angeordnet.
Würfelmarketerie: Aus drei unterschiedlich getönten Holzarten zusammengesetztes Furniermuster, das optisch den Eindruck von aufeinandergeschichteten Würfeln vermittelt (18.Jahrhundert).
Wurzelmaser (Wurzelfurnier): Stark gemusterte und gewölbte Maserung, bes. bei * Nussbaum; aus dem dunkleren Kernholz des quergesägten Stammes oder aus Aststellen und Verwachsungen gewonnen.
X
X Füllung: Spätgotisches Schmuckmotiv rheinischer, flandrischer und nordd. Eichenmöbel von etwa 1450 bis 1550 neben dem * Faltwerk; die X Füllung besteht aus sich x förmig kreuzenden oder berührenden Holzkehlen und Rundstäben aufranken oder ornamentgeschmücktem Grund.
Z
Zahnschnittleiste: Eine Reihung von kleinen, durch enge Zwischenräume (Zahnlücken) getrennten, würfelförmigen Klötzchen (Zähne); als Zierleiste in der antiken Architektur und in der späteren Möbelkunst angewendet.
Zarge: Horizontales Verbindungsstück zw. zwei Pfosten, z. B. unter Tischplatten, Stuhlsitzen, Canapes oder auch am unteren Ende von Kommoden oder Schränken.
Ziehbank: Etwa 1565 in Nürnberg erfunden; ermöglichte die Herstellung von Profilleisten, wobei sich die Leiste und nicht, wie beim Profilhobel, das Schneidemesser bewegte.
Ziehdocken: Gedrechselte Holzpuppen mit Wickelkind auf den beweglichen Armen, das mittels Schnüren im Körper hochgehoben werden kann.
Zirkelschlagornamentik: Geometrische Muster, aus einzelnen Kreisen oder Kreissegmenten gebildet, wobei sich mehrere Kreise berühren und überschneiden können; bei Bauernmöbel an Schnitzverzierungen anzutreffen.
Zopfstil: Dem * Louis-Seize entsprechender Kunststil in MA Deutschland (1770 1790). nordd.
Zunge (Mittelzunge): Im Rahmen der Stuhllehne verbreitertes Mittelholz; häufig ornamental geschweift. Zwei Gesichter Puppen: Puppen, meist mit einem lachenden und einem weinenden Gesicht (oder seltener mit einem weißen und einem schwarzen), deren eines durch leichte Drehung unter der Perücke verborgen werden kann.
Zweites Rokoko: * Louis Philippe Stil.
Zwickel: Keilförmiges Verbindungsstück zw. d. Rahmenwerk.
Zylinderbureau (Rollbureau): Schreibmöbel, das in seinem mittleren Teil durch einen Halb oder Viertelzylinder geschlossen wird; oft in der Form einer Jalousie; beim Rollbureau handelt es sich um einen halbzylindrischen Rollverschluss aus Holz; beim Öffnen versenkt sich der Verschluss zw. Rückwand und Schubladenteil und bewirkt gleichzeitig ein Vorrücken der Tischplatte (von Graf Kaunitz entworfene Konstruktion); seit Mitte des 18.Jhs. in Gebrauch.
Zylinderschreibtisch: * Zylinderbureau.
Verwendete Abkürzungen:
am. = amerikanisch
ausschl. = ausschließlich
bes. = besonders
Bz. = Bezeichnung
bzw. = beziehungsweise
ca. = cirka
chin. = chinesisch
dt. = deutsch
engl.= englisch
etc. = et cetera (usw.)
europ. = europäisch
frz. = französisch
gegr. = gegründet
holl. = holländisch
ital. = italienisch
Japan. = japanisch
Jh. = Jahrhundert
m. = mit
MA = Mittelalter
nordd. = norddeutsch
om. = ornamental
österr. = österreichisch
s. = siehe
sog. = sogenannt
südd. = süddeutsch
sym. = symmetrisch
u. = und
u.a. = und andere bzw. unter anderem
u.ä. = und ähnliche
urspr. = ursprünglich
v.a.= vor allem
vollst. = vollständig
z. = zur
z.B.= zum Beispiel
zw. = zwischen